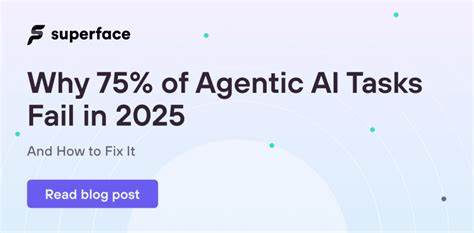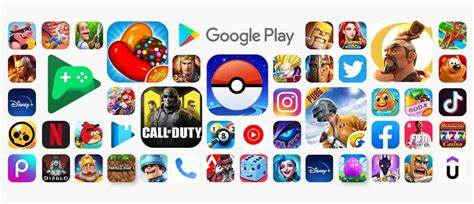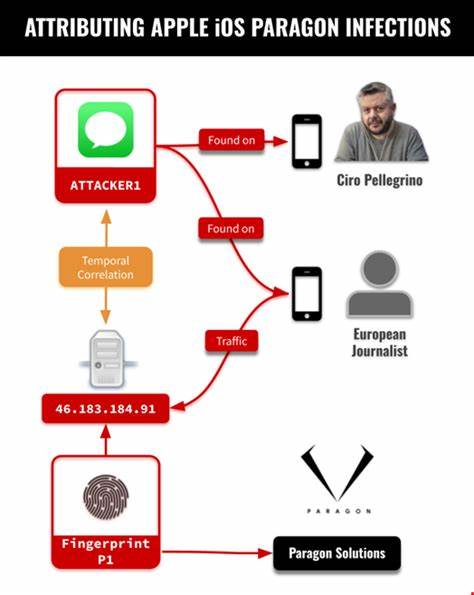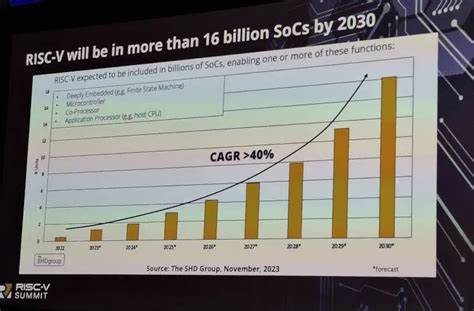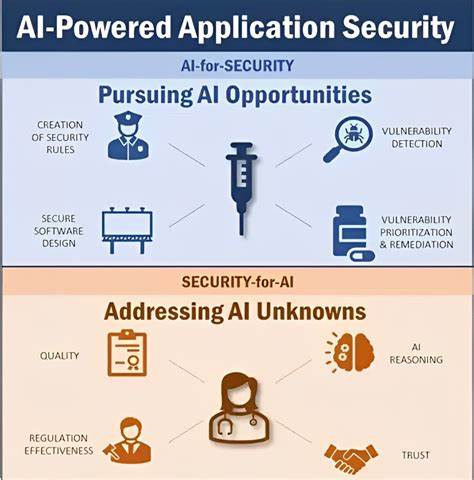Fledermäuse spielen eine entscheidende Rolle in unseren Ökosystemen. Sie helfen bei der Bestäubung, kontrollieren Insektenpopulationen und tragen zur Artenvielfalt bei. Doch ihre Bestände geraten weltweit zunehmend unter Druck. Eine der verheerendsten Bedrohungen ist die sogenannte weiße-Nasen-Krankheit, eine Pilzinfektion, die in den letzten zwei Jahrzehnten Millionen von Fledermäusen das Leben gekostet hat. Neueste Forschungen zeigen nun, dass hinter dieser Krankheit nicht nur ein einziger Pilz steht, sondern gleich zwei verschiedene Arten, was das Bild der Bedrohung deutlich komplexer macht und neue Fragen sowie Herausforderungen für den Artenschutz aufwirft.
Die weiße-Nasen-Krankheit wurde erstmals Mitte der 2000er Jahre auffällig, als Fledermauspopulationen in Höhlen im Bundesstaat New York massiv zurückgingen. Das auffällige weiße, pudrige Wachstum am Nasenbereich der Tiere stellte sich als der zunächst unbekannte Pilz Pseudogymnoascus destructans heraus. Diese Krankheit breitet sich seitdem rasch über Nordamerika aus und hat bereits mehr als 90 Prozent der Populationen in manchen Regionen ausgelöscht. Sie zählt zu den größten Seuchen, die je bei Säugetieren verzeichnet wurden.Bislang wurde angenommen, dass ein einziger Pilz für diese Epidemie verantwortlich sei, der ursprünglich aus Eurasien stammt.
Diese ursprüngliche Sichtweise hat sich jedoch durch eine umfangreiche Studie geändert, die im Mai 2025 in der renommierten Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde. Ein internationales Forscherteam analysierte fast 5500 Proben von Höhlenpilzen aus Europa, Asien und Nordamerika. Die Studie beweist, dass zwei unterschiedliche Pilzarten an der Entstehung der weißen-Nasen-Krankheit beteiligt sind. Während in Nordamerika bisher nur eine dieser Arten aufgetreten ist, wurde die zweite Spezies bisher nur in Eurasien nachgewiesen. Allerdings besteht große Sorge, dass auch sie in naher Zukunft nach Nordamerika eingeschleppt werden könnte.
Diese neue Erkenntnis ist aus mehreren Gründen äußerst beunruhigend. Die zweite Pilzart zeigt eine andere Spezialisierung auf verschiedene Fledermausarten. Sollte sie in Nordamerika Fuß fassen, könnte sie Arten infizieren, die bislang von der ersten Pilzart verschont geblieben sind. Sogar Populationen, die sich von der ursprünglichen Epidemie gerade zu erholen scheinen, könnten erneut gefährdet sein. Insgesamt könnte die Einführung des zweiten Pilzes zu noch dramatischeren Verlusten führen, als bisher angenommen.
Diese Aussicht veranschaulicht die enorme Komplexität von Krankheitserregern in der Natur und wie menschliche Aktivitäten ahnungslos zu Katastrophen beitragen können.Die Genanalyse der Proben hat zudem zur Klärung der Herkunft der Pilze beigetragen. Demnach stammt die Epidemie in Nordamerika aus der Podillia-Region in der Ukraine, einer Gegend mit einigen der größten Höhlensysteme weltweit. Besonders internationaler Höhlenforscher-Tourismus, vor allem aus den USA, wird als wahrscheinliche Ursache der versehentlichen Pilzverbreitung gesehen. Die Forschung legt nahe, dass es sich um einen einzigen einschleppenden Vorfall handelt, der jedoch massive Konsequenzen entfaltet hat.
Dies unterstreicht, wie wichtig Umsicht und Vorsorge bei der Erschließung natürlicher Lebensräume sind.Das Wissen um die Entstehung und Ausbreitung der weißen-Nasen-Krankheit weist auf dringende Handlungsfelder hin. Insbesondere im Bereich der Biosicherheit bei Höhlenforschung besteht großer Nachholbedarf. Um die Verbreitung von pathogenen Pilzsporen zu verhindern, muss die Reinigung und Desinfektion der Ausrüstung aller Höhlenforscher und Touristen systematisch und gründlich erfolgen. „Biologische Verschmutzung“ durch Menschen verursacht Risiken, die nicht nur für die Zielarten, also die Fledermäuse, sondern auch für das gesamte ökologische Gleichgewicht weitreichende Folgen haben können.
Ein nachhaltiges Management dieser Risiken ist essenziell, um die Biodiversität zu erhalten.Besonders bemerkenswert ist die Rolle von Freiwilligen in dieser Forschung. Mehr als 360 ehrenamtliche Helfer, vor allem Spezialisten für Fledermauskunde, haben zu Datensammlung und Probenanalyse beigetragen. Diese breite Beteiligung zeigt eindrucksvoll, wie Bürgerwissenschaft den wissenschaftlichen Fortschritt beschleunigen und Qualitätsergebnisse ermöglichen kann. Dabei erfordert die Organisation, Schulung und Vernetzung der Helfer ein hohes Maß an Engagement und Kooperation zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit.
Der Erfolg solcher Gemeinschaftsprojekte könnte Vorbildcharakter für zukünftige Umwelt- und Naturschutzforschungen haben.Fledermäuse sind aus ökologischer Sicht wertvolle Tiere, die durch die weiße-Nasen-Krankheit stark gefährdet sind. Ihr Verschwinden hätte weitreichende Folgen für Insektenbekämpfung und Bestäubung, die letztlich auch den Menschen betreffen. Die Erkenntnisse über die zwei Pilzarten und deren Herkunft bieten jedoch auch eine Chance, den Artenschutz zu verbessern. Für ein effektives Vorgehen gegen die Ausbreitung der Krankheit werden verstärkte internationale Zusammenarbeit, strengere Biosicherheitskonzepte und erhöhte Öffentlichkeitsarbeit erforderlich sein.
Nur so kann das Risiko weiterer Epidemien eingedämmt und die Erhaltung der Fledermauspopulationen nachhaltig gesichert werden.Insgesamt offenbart die neueste Forschung, wie komplex und dynamisch die Beziehungen zwischen Krankheitserregern und Wirtsarten sein können. Sie verdeutlicht die schwerwiegenden Folgen unbedachter menschlicher Eingriffe in sensible Ökosysteme und mahnt zu Verantwortung im Umgang mit der Natur. Zudem zeigt sie die Bedeutung moderner molekularbiologischer Untersuchungen und die Potenziale gemeinschaftlicher Forschungsprojekte auf. Fledermäuse stehen stellvertretend für viele wildlebende Arten, die durch Krankheitserreger in Kombination mit menschlichen Aktivitäten existenziell bedroht sind.
Daher ist die Entwicklung umfassender Schutzstrategien nicht nur eine ökologische, sondern auch eine ethische Herausforderung unserer Zeit.Es bleibt zu hoffen, dass diese neuen Erkenntnisse zu einem Umdenken in Forschung, Naturschutz und Bevölkerung führen. Durch den Austausch von Wissen, die Umsetzung strengerer Hygienepraktiken bei der Höhlenforschung und die Wachsamkeit gegenüber neuen Gefahren kann die weitere Ausbreitung der gefährlichen Pilzarten unterbunden werden. Letztlich liegt es in unserer Verantwortung, die Vielfalt und Gesundheit unserer Natur zu bewahren – für zukünftige Generationen und das stabile Funktionieren der natürlichen Lebensgemeinschaften, in denen Fledermäuse eine unverzichtbare Rolle spielen.