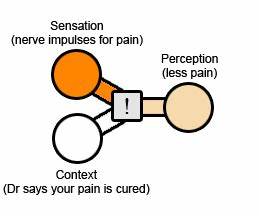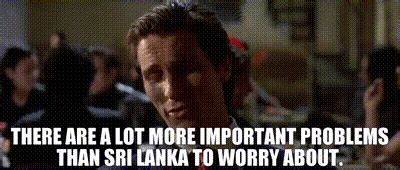Im Mai 2025 fällte das US-amerikanische Court of International Trade in New York ein wegweisendes Urteil, das Präsident Donald Trump einen empfindlichen Rückschlag bei seiner Handelspolitik beschert. Das Gericht stellte klar, dass der damalige Präsident bei der Verhängung globaler Zölle seine rechtlichen Befugnisse überschritten habe, indem er ein Notstandsgesetz aus dem Jahr 1977 als Begründung für nahezu alle Importzölle anführte. Diese Entscheidung hat nicht nur innenpolitische Auswirkungen, sondern bringt auch Handelspartner und Unternehmen weltweit in Unsicherheit. Die juristische Auseinandersetzung entstand im Kontext der sogenannten „Liberation Day“ Zölle, einer radikalen Zollpolitik, die Trump im April 2025 verkündete. Dabei wurden Einfuhrsteuern von mindestens zehn Prozent auf Waren aus fast allen wichtigsten Handelspartnerländern der USA verhängt.
Ziel dieser Maßnahme war es, die amerikanische Industrie zu stärken, Arbeitsplätze zu schützen und vermeintlich unfaire Handelspraktiken gegenzusteuern. Die Zölle führten jedoch zu erheblichen Turbulenzen in den globalen Märkten und riefen zugleich eine breite Front von Kritikern und Klägern auf den Plan. Die Klage vor dem Handelsgericht resultierte aus zwei gesprochenen Fällen: Zum einen reichte die gemeinnützige Liberty Justice Center Klage im Namen mehrerer kleiner Importfirmen ein, die direkt von den Schwellenzöllen betroffen waren. Zum anderen förderte eine Koalition aus mehreren US-Bundesstaaten die rechtliche Überprüfung der Zölle. In beiden Fällen argumentierten die Kläger, dass die Verhängung dieser Zölle durch das von Trump zitierte International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) nicht legal sei, da dieses Gesetz dem Präsidenten nicht die pauschale Macht einräume, Warenimporte aus einer Vielzahl von Ländern mit Zöllen zu belegen.
Die drei Richter der Handelsgerichtssitzung gaben den Klägern Recht. Sie erklärten, dass gemäß der US-Verfassung allein der Kongress die exklusive Befugnis habe, den Handel mit anderen Ländern zu regeln. Dieses Recht könne nicht durch eine Notstandsgesetzgebung des Präsidenten ausgehebelt werden. Das Gericht hob zudem weitere Strafzölle auf, die Trump auf China, Mexiko und Kanada verhängt hatte, im Zusammenhang mit den Themen Drogen- und Migrationsbekämpfung. Interessanterweise blieb die Rechtsprechung zu spezifischeren Zöllen auf Autos, Stahl und Aluminium im Rahmen anderer gesetzlicher Grundlagen unberührt.
Die Reaktionen auf das Urteil fielen unterschiedlich aus. Präsident Trump selbst reagierte auf seiner Plattform Truth Social mit scharfer Kritik am Urteil und den Richtern, denen er vorwarf, den Schutz Amerikas wirtschaftlicher Interessen zu behindern. Er betonte, dass der Präsident das Recht haben müsse, das Land ökonomisch gegen schädliche Effekte abzusichern. Im Gegensatz dazu feierten zivilgesellschaftliche Akteure und Bundesstaaten wie New York unter der Leitung von Generalstaatsanwältin Letitia James die klare Absage an die Machtüberdehnung des Präsidenten. James betonte, dass kein Präsident befugt sei, eigenmächtig Steuern zu erhöhen oder Importzölle ohne legislative Grundlage zu verhängen.
Trotz des Urteils bleiben die Zölle vorerst bestehen. Das Gericht gestattete, dass Zölle bis zu 15 Prozent für maximal 150 Tage durch den Präsidenten verhängt werden können, falls dies zur Behandlung von Handelsungleichgewichten notwendig sei. Experten von Goldman Sachs weisen darauf hin, dass die US-Regierung diese Möglichkeit nutzen könnte, um ähnliche, aber rechtlich gepflegte Zölle einzuführen. Weiterhin werden Optionen evaluiert, andere bestehende Gesetze zu nutzen, die Zölle etwa aus Gründen der nationalen Sicherheit oder wegen unfairer Handelspraxen erlauben, allerdings sind dafür längere Untersuchungs- und Konsultationsphasen vorgesehen. Die Handelspolitik Trumps im Rahmen dieser Zölle war grundsätzlich auf eine merkliche Umstrukturierung der internationalen Handelsbeziehungen ausgelegt.
Mit dem sogenannten „Liberation Day“ wurden erstmals beinahe alle großen Handelspartner wie die EU, China, Vietnam oder Großbritannien mit Zollerhöhungen konfrontiert, was zu Verunsicherungen und Hemmnissen in globalen Lieferketten führte. Die Initiative stieß international auf massive Ablehnung und Gegenmaßnahmen seitens der betroffenen Länder. Die USA stehen zudem vor strategischen Herausforderungen, da der laufende Zollstreit unmittelbar in komplizierte Verhandlungen mit wichtigen Partnern wie Großbritannien und der EU hineinspielt. So betrifft das Gerichtsurteil auch die Umsetzung eines zwischen den USA und Großbritannien ausgehandelten Tarifdeals, bei dem bisher vereinbarte Zollsenkungen mit Fragezeichen versehen sind. Für die betroffenen Unternehmen bedeutet die rechtliche Unsicherheit derzeit einen enormen Handlungsdruck.
Produktion, Lieferkettenmanagement, Preisgestaltung und internationale Verträge müssen neu bewertet werden. Viele kleinere Importeure, die sich gegen die Zölle gewandt hatten, fühlen sich durch das Urteil bestätigt, gleichzeitig aber durch die angesetzte Berufungsverhandlung weiterhin im Ungewissen gelassen. Sollte das Verfahren bis zum Obersten Gericht der USA gehen, könnte dies zu einer endgültigen Klärung führen, allerdings ist dabei nicht ausgeschlossen, dass auch dort eine differenzierte Entscheidung gefällt wird, die den Präsidenten nicht völlig entmachtet. Im Kern geht es bei der juristischen Auseinandersetzung nicht nur um Handelspolitik, sondern um die Gewaltenteilung und die Balance zwischen Exekutive und Legislative. Das Urteil setzt ein starkes Signal, dass selbst in wirtschaftlichen Notlagen keine willkürliche Gesetzgebung durch den Präsidenten möglich ist.