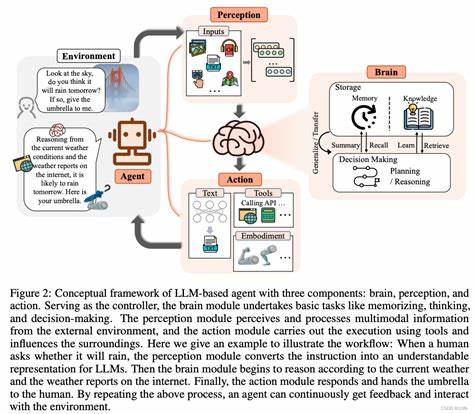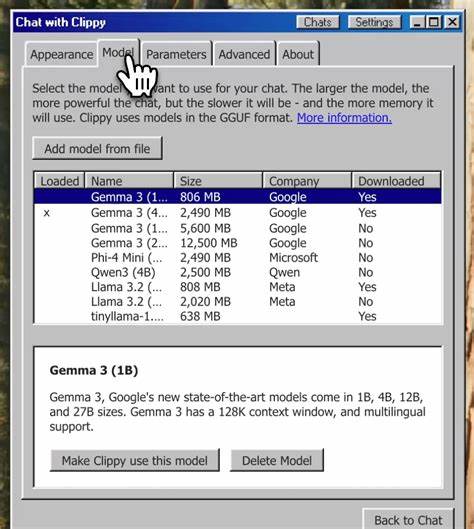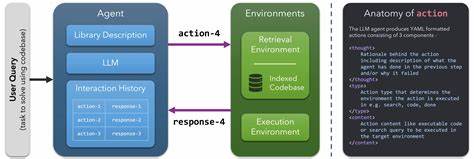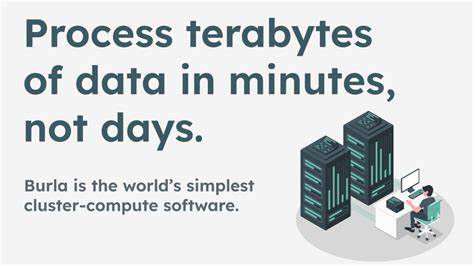Die Geschichte des Pale Ale ist eng mit der Entwicklung neuer Techniken in der Malzdarrung verbunden, die im 17. Jahrhundert in England ihren Anfang nahmen. Lange bevor das Pale Ale als eigenständige Biersorte bekannt wurde, konnten Überlieferungen und technische Neuerungen im Bereich der Malzherstellung als treibende Kraft dafür angesehen werden. Die Herausforderung bestand darin, hochwertigen, hellen und rauchfreien Malz herzustellen, der für ein mildes und bekömmliches Bier unabdingbar war. Gerade in der damals rauchigen und feuchten Atmosphäre des nordwestlichen Europas war dies keine einfache Aufgabe.
Die Innovationsgeschichte zeigt, wie technisches Geschick, wechselnde Rohstoffe und politische Einflüsse diesen Prozess maßgeblich prägten. Schon im 16. Jahrhundert versuchten Brauer, durch indirektes Erhitzen von Wasser und Sud Raum für die Nutzung von Kohle zu schaffen, ohne dass deren rußige und schwefelhaltige Dämpfe den Geschmack beeinträchtigten. Während diese Technik – die sogenannte Holzersparungskunst – den Brauprozess selbst revolutionierte, blieb die Malzdarrung zunächst weiter auf traditionelle Methoden angewiesen. In diesem Bereich waren es jedoch die sogenannten Malzbereiter, die mit ihrem Wissen über Hitze und Trocknung den Weg ebneten, um endlich Kohle auch beim Malzdarren nutzen zu können.
Die Grundproblematik beim Malzdarren lag im Prozess selbst: Das gekeimte Korn musste so getrocknet werden, dass es nicht weiter keimte und alle dafür wichtigen Enzyme erhalten blieben, während gleichzeitig eine zu starke Erhitzung oder das Eindringen von Rauch vermieden werden musste. Dabei wurde der Malz auf einem durchlässigen Untergrund – einer „Bettung“ aus Schilf, Weidenruten oder Stroh – ausgelegt, über dem ein Feuer entfacht wurde. Traditionell war dieses Feuer mit Holz oder Stroh befeuert, doch diese Materialien brachten ihre eigenen Probleme mit sich. Holzrauch war zwar leichter zu kontrollieren, jedoch teuer und immer knapper, während Stroh kostengünstiger, aber schwieriger gleichmäßig zu verbrennen war. Zudem konnten die meisten britischen Kohlearten wegen ihrer hohen Rauch- und Schwefelanteile nicht direkt verwendet werden.
Besonders reine Kohle, Anthrazit aus Wales, gewann an Bedeutung, da sie kaum Rauch entwickelte und somit theoretisch für den Darrprozess geeignet war. Doch Anthrazit war rar und hart zu fördern. Die Mehrheit der Kohlevorkommen war stark schwefelhaltig und für den Malzdarren ungeeignet. Daraus ergab sich ein bedeutendes Innovationsproblem: Wie ließ sich billige, weitverbreitete Kohle nutzen, ohne dass die Malzkörner durch Rauch beeinträchtigt wurden? Die Antwort lag in der Trennung von Feuer und Malz – eine indirekte Hitzezufuhr, die das Problem des Rauchs löste. Schon im Jahr 1573 berichtete ein englischer Spion über ein in Holland gebräuchliches Dünstmalthaus, das mit indirekter Wassererwärmung funktionierte und somit Kohle als Brennstoff nutzen konnte, ohne das Malz zu verunreinigen.
Ende des 16. Jahrhunderts publizierte auch der Londoner Autor Hugh Plat seine Version eines solchen indirekten Malzdarrens, bei dem das Malz nicht direkt über einem Feuer lag, sondern auf einer Bleiplatte, die von unter der Erde verlaufenden Flammen erwärmt wurde. Dieses System ermöglichte eine weitgehende Isolierung des Malzes vom Rauch und erlaubte es, Kohle – sogar die ansonsten wenig geeignete Newcastle-Kohle – einzusetzen. Trotz dieser veröffentlichten Ideen fanden sie kaum praktische Anwendung. Der Fortschritt scheiterte an technischen Herausforderungen und daran, dass sich etablierte Interessen gegen Innovationen wehrten.
Parallel dazu gab es immer wieder Hinweise auf den Einsatz sogenannter „Französischer Kilanlagen“, die wohl mit Ziegeln und Bauschutt stabilisiert waren und durch komplexe Luftführung den Rauch weitgehend entfernten. Solche Anlagen konnten jedoch nicht den kompletten Verzicht auf Rauch garantieren und waren auch nicht überall anwendbar. Im frühen 17. Jahrhundert setzte sich ein Unternehmer namens John Shotbolt dafür ein, einen indirekten Malzdarr zu verwirklichen, der auch als Patent angemeldet wurde. Die Anlage arbeitete mit Eisenbauten und Luftröhren, die Rauch vom Malz fernhalten sollten, während die Hitze erhalten blieb.
Dieses Konstrukt war ein typischer Ausdruck des industriellen Eifers jener Zeit, bei der Verfeinerung und Automatisierung von Fertigungsprozessen eine zunehmend wichtige Rolle spielten. Ein Problem blieb allerdings die Patentsituation: Der Markt war umkämpft, verschiedene Erfinder – darunter Nicholas Page und die Erben von Cornelis Drebbel – hatten eigene, zum Teil konkurrierende Konzepte präsentiert, was zu politischen Intrigen und juristischen Auseinandersetzungen führte. Besonders die Einflussnahme mächtiger Familien wie der Howards, die sich Patente sicherten und Rivalen ausschalteten, verzögerte die Generierung einer einheitlichen technischen Lösung. Cornelis Drebbel, ein Erfinder aus den Niederlanden, erlangte mit seiner thermostatisch gesteuerten Ofentechnik große Anerkennung. Sein innovatives System erlaubte eine automatische Temperaturregelung mittels eines Thermometers und eines Luftklappenmechanismus.
Diese Neuerung machte die sonst notwendige Kunst des ständigen Feueranschürens und Temperaturüberwachens überflüssig. Statt eines schwankenden und schwer zu kontrollierenden Brennvorgangs konnte man eine konstante und präzise Trocknung erreichen. Trotz der hohen Effizienz dieser Technologie fand Drebbel’s Verfahren in England zunächst kaum Verbreitung. Einflussreiche Gegner sorgten für Verzögerungen, und mit den politischen Turbulenzen um die englische Bürgerkriegszeit kam es zu einem Ausbleiben der durchschlagenden industriellen Adoption. Erst Jahrzehnte später kamen diese Innovationen über Umwege und mit verbesserten Technologien zu breiter Anwendung.
Die Rückkehr der Kuffler-Brüder, die Drebbel’s Erfindungen verwalteten, 1656 nach England markierte einen Wendepunkt, doch zu diesem Zeitpunkt hatten sich alternative Konzepte entwickelt, wie die Rauchbehandlung oder Reinigung der Kohle selbst, die die direkte Nutzung in Malzdarren erlaubten. Das Vorantreiben neuer patentierter Lösungen, die quasi eine Rauchmauer zwischen Feuer und Malz etablierten, spiegelt wider, wie eng technischer Fortschritt mit gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen verknüpft ist. Der enorme Bedarf an hochwertigem Malz angesichts einer wachsenden Bevölkerung und einer steigenden Nachfrage nach Bier führte zum Engagement wirtschaftlicher Eliten und einer verstärkten Regulierung. Die Vorstellung, ein ganzes Handwerk durch eine Gesellschaft mit Monopolrechten zu organisieren – etwa die geplante Gesellschaft der Malzbereiter – zeigt die Verbindung von Innovation und politischem Machtanspruch. Letztlich war die Entwicklung der indirekten Malzdarrverfahren ein entscheidender Schritt, um die Qualität des Malzes, und damit des Pale Ale, zu verbessern.
Sie erlaubte nicht nur eine breitere Nutzung von Kohle als billigem Brennstoff, sondern auch eine gleichmäßigere und schonendere Trocknung, die den Geschmack eines Bieres deutlich beeinflusst. Die Innovationsgeschichte des Malzdarrens reflektiert somit einerseits den Drang nach Technologisierung, andererseits aber auch das Ringen um Patente, Marktbeherrschung und politische Unterstützung. Heute erinnern wir uns daran, dass die malzverarbeitenden Kilns des 17. Jahrhunderts eine stille Revolution in der Brauerei waren, die auch zu industriellen und gesellschaftlichen Umwälzungen beitrugen. Der Übergang von holz- zu kohlebefeuerten Verfahren war kein simpler technischer Wechsel, sondern ein langsamer und vielschichtiger Prozess, der auf den Schultern von Erfindern, Unternehmern und politischen Akteuren ruhte.
Die scheinbar alltägliche Frage, wie man besten Malz trocknete, war demnach ein zentrales Element für die Entwicklung eines der populärsten Getränke Englands und spielte eine bedeutende Rolle auf dem Weg zur industriellen Moderne. In der Fortsetzung dieser Geschichte wird erläutert, wie durch neue Methoden zur Rauchreduktion bei der Kohle selbst das Darrerlebnis revolutioniert wurde und wie dies die Verbreitung des Pale Ale maßgeblich beschleunigte. Die Erkenntnisse und Erfindungen jener Zeit liefern spannende Einblicke in die frühe Industriegeschichte und zeigen, dass Innovationen immer einem komplexen Geflecht aus Technik, Gesellschaft und Politik entspringen.