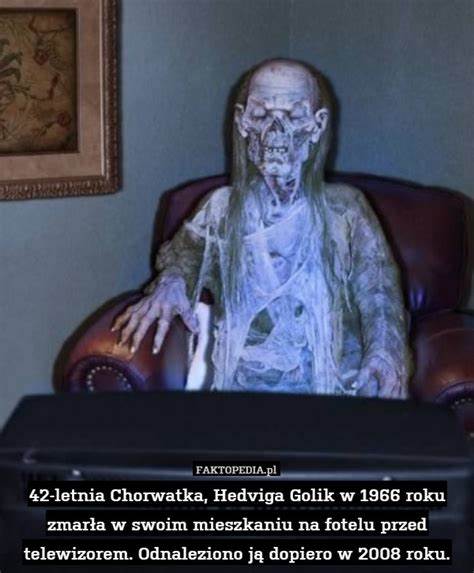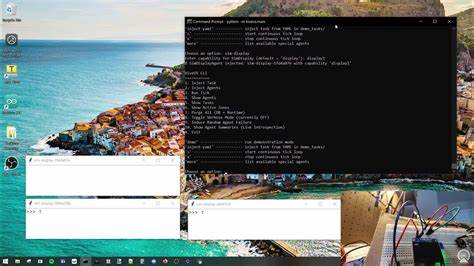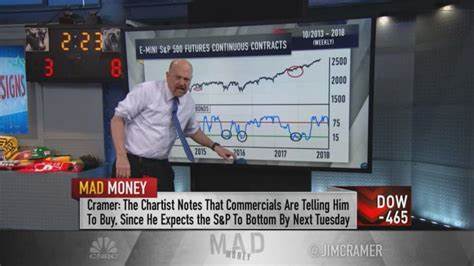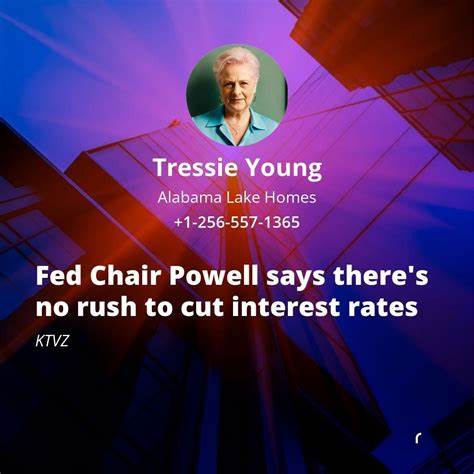Die Geschichte von Hedviga Golik ist eine jener tragischen Begebenheiten, die weit über das gewöhnliche Maß hinausgehen und im kollektiven Gedächtnis haften bleiben. Die Frau aus Zagreb ist eine bedeutende Figur in der Diskussion um soziale Isolation und unbeachtete Einsamkeit. Als ehemalige Krankenschwester, deren Leichnam über vier Jahrzehnte hinweg unbeachtet in ihrer Wohnung lag, verdeutlicht ihr Schicksal auf bedrückende Weise, wie Menschen im Alltag unsichtbar werden können – selbst in belebten Stadtvierteln. Hedviga Golik wurde 1924 in Fiume, dem heutigen Rijeka, geboren und zog später in die kroatische Hauptstadt Zagreb. Sie lebte alleine in einem kleinen Dachgeschossapartment im Stadtviertel Medveščak, in der Nähe des Platzes Gupčeva zvijezda.
Dieses Apartment war lediglich 18 Quadratmeter groß und befand sich isoliert von den unteren Stockwerken eines Mehrfamilienhauses. Ihr Leben zeichnete sich durch Abgeschiedenheit und eine gewisse soziale Distanz zu ihren Nachbarn aus. Schließlich verbrachte sie dort Jahrzehnte nahezu zurückgezogen. Im letzten Teil ihres Arbeitslebens war Hedviga Golik als Krankenschwester in einem Gesundheitszentrum in Trešnjevka tätig. Ihre Wohnung wurde ihr von einem ehemaligen Freund und Hausverwalter namens Hinković überlassen, der wie sie der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas angehörte.
Dies erklärt möglicherweise auch die zurückhaltende und verschlossene Natur, die sie gegenüber ihrer Umgebung zeigte. Der Kontakt zu ihrer Schwester, die als Lehrerin in Zagreb arbeitete, war durch Streitigkeiten abgebrochen. Dies trug sicherlich zu ihrer Isolation bei und ließ sie zunehmend vereinsamen. Die Nachbarn beschrieben Hedviga Golik als sonderbar und mit stark schwankenden Stimmungslagen. Einerseits zog sie sich vollkommen zurück und zeigte sich sehr ruhig, andererseits war sie gelegentlich laut und aggressiv.
Es wird vermutet, dass sie an einer psychischen Erkrankung wie Schizophrenie litt, was auch ihre wechselhafte Art erklärte. Trotz der merkwürdigen Verhaltensweisen war sie niemals wirklich Teil des nachbarschaftlichen Lebens. Für ihre Einkäufe und sonstige Besorgungen ließ sie Niederschriften und Geld in einem Behälter nach unten befördern, ohne selbst das Dachgeschoss zu verlassen. Von Zeit zu Zeit vermietete sie ihre Wohnung auch an Dritte. Die letzte Zeit, zu der sie noch lebend gesehen wurde, ist umstritten und reicht von den 1960er bis in die frühen 1970er Jahre.
Die genauen Umstände ihres Todes sind unbekannt. Im Jahr 1966 bereitete sie sich einen Tee zu und setzte sich vor den Fernseher – doch sie starb in ihrer Wohnung aus ungeklärten natürlichen Ursachen. Während sie ihren Nachbarn sagte, dass sie für einige Zeit verreisen würde, entschied sie sich offenbar dazu, nie wieder zurückzukehren. Ihre Nachbarn und öffentliche Stellen gingen zunächst davon aus, dass sie umgezogen sei oder sich anderenorts aufhalte. Gerüchte, sie sei einer Sekte in einem anderen jugoslawischen Bundesstaat beigetreten oder habe sich zu Verwandten nach Belgrad begeben, wurden verbreitet.
Die Wohnung blieb verschlossen und unbeachtet, da die anderen Bewohner aus Respekt vor den Mietrechten nicht eintraten. Die Polizei verzeichnete nie eine offizielle Vermisstenanzeige, lediglich eine informelle Meldung aus dem Jahr 1973 brachte Bewegung in die Angelegenheit. Frühere Versuche, sie in anderen Regionen Jugoslawiens zu finden, blieben erfolglos. Die Bewohner bemerkten offenbar bereits Anfang der 1980er Jahre, dass etwas mit der Wohnung nicht stimmte, besonders als einige Verpflichtungen wie die Rückzahlung eines Kredites bedient wurden. Doch anstatt die Behörden zu informieren, entbrannten Streitigkeiten unter den Nachbarn darüber, wer Anspruch auf die kleine Dachgeschosswohnung erheben durfte.
Jeder glaubte, zumindest einen kleinen Teil des Apartments für sich beanspruchen zu können. Die Erb- und Besitzverhältnisse waren unklar, da die Wohnung ursprünglich nicht offiziell ihrem Eigentum zugeordnet war. Die Ungewissheit wurde durch politische und gesellschaftliche Umbrüche der 1990er Jahre verstärkt. Meldungen an die Stadtverwaltung blieben unbeantwortet, während die kriegerischen Auseinandersetzungen in Kroatien den Blick auf solche „kleinen“ Belange verdeckten. Im Jahr 1998 tauchte an der Wohnungstür ein handgeschriebener Zettel mit dem Stempel einer vermeintlichen städtischen Behörde auf.
Darin wurde erklärt, dass die Mieterin das Eigentum und Erbrecht an der Wohnung verloren habe und bis zur Klärung der Besitzverhältnisse kein Zugriff auf die Wohnung gestattet sei – jede unbefugte Nutzung wäre ein strafbares Vergehen. Obwohl der Zettel von einem anonymen Nachbarn stammte, glaubten die Bewohner der Botschaft und stellten ihre Bemühungen ein. Erst im Jahr 2008, als eine umfangreiche Renovierung und Umwandlung des Gebäudes in Eigentumswohnungen anstand, wurde die Dachgeschosswohnung einer genaueren Kontrolle unterzogen. Drei Vertreter der Wohnungseigentümergemeinschaft öffneten am 12. Mai 2008 die Tür und fanden die sterbliche Überreste von Hedviga Golik.
Ihr Körper lag zusammengerollt in Decken auf dem Bett, vor dem Fernseher, mit der halb geleerten Teetasse auf dem Tisch neben ihrem Sessels. Trotz der langen Zeit hatte sich niemand in die Wohnung gewagt. Der Raum war stark mit Spinnweben durchzogen, jedoch wirkte das Inventar nicht gestört. Die Polizei entfernte den Leichnam zur weiteren Untersuchung, doch die Obduktion konnte weder die exakte Todesursache noch den Zeitpunkt praktisch bestimmen. Experten schätzten, dass Hedviga in einer kalten Jahreszeit verstorben sein könnte.
Durch die isolierte Lage der Wohnung und die geschlossene Tür zersetzte sich der Körper langsam und wurde mumifiziert, weshalb der Geruch des Verfalls offenbar erst spät wahrgenommen wurde. Die Nachbarn hatten angegeben, erst nach dem Öffnen der Tür einen modrigen Geruch bemerkt zu haben. Die Stromversorgung der Wohnung blieb während der Jahrzehnte unverändert, was ungewöhnlich erschien. Die Rechnungen zahlte ein Architekt, der das Gebäude geplant hatte und ebenfalls in Zagreb wohnte. Er war wenige Monate vor der Entdeckung verstorben.
Die Polizei staunte, dass eine Person so lange unbeachtet in ihrer eigenen Wohnung liegen konnte, obwohl sie lange vermisst wurde und Nachbarn Berührung zur Wohnung hatten. Die Geschichte von Hedviga Golik rief weltweites Interesse hervor und wurde in zahlreichen Medien aufgegriffen. Ihr Fall gilt als Beispiel eines sogenannten Kodokushi, was aus dem Japanischen stammt und den einsamen Tod bezeichnet, der von anderen erst nach längerer Zeit entdeckt wird. Es erinnert schmerzlich daran, wie Isolation, Fremdheit und mangelnde soziale Kontakte Menschen regelrecht verschwinden lassen können, selbst in urbanen Gegenden mit dichtem Miteinander. Gleichzeitig wirft der Fall Fragen auf, wie das Mietrecht, Nachbarschaftsbeziehungen und gesellschaftliche Verantwortung besser gestaltet werden können.
Hedvigas Schicksal mahnt zur Sensibilität gegenüber Menschen am Rande der Gemeinschaft, die durch Krankheit, Einsamkeit oder Konflikte von der Teilnahme am sozialen Leben abgeschnitten sind. Die Tragödie zeigt, dass gesellschaftliche Netzwerke nicht nur soziale Bedeutung haben, sondern Leben retten können, indem sie Warnzeichen interpretieren und eingreifen. Trotz der Widrigkeiten und Unklarheiten bleibt Hedviga Golik eine prominente Erinnerung an die Schattenseiten der Moderne. Die Nachwelt kann aus ihrem Fall Lehren ziehen, wie Menschlichkeit, Achtsamkeit und Gemeinschaftssinn den Unterschied machen können – bei der Verhinderung solcher unbemerkter Einzelschicksale und beim Aufbau eines sozialen Umfeldes, das niemanden zurücklässt. Ihr stiller Tod vor dem Fernseher, über Jahrzehnte unbeachtet, wird weltweit als Symbol für Einsamkeit im urbanen Raum wahrgenommen.
Es bleibt zu hoffen, dass ihr Schicksal zum Nachdenken anregt und dafür sorgt, dass Einsamkeit nicht länger unsichtbar im Verborgenen bleibt.