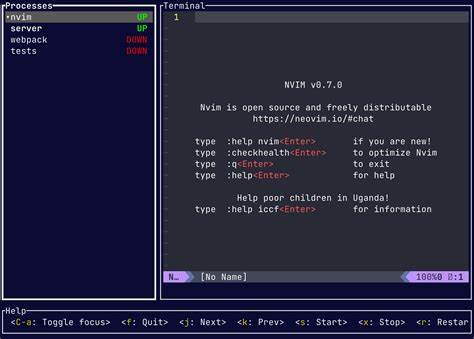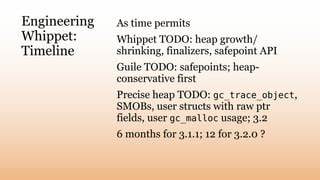Manhattan, das Herzstück von New York City, ist weltweit bekannt für seine ikonischen Wolkenkratzer, historischen Gebäude und ein urbanes Geflecht, das Geschichte und Moderne auf faszinierende Weise miteinander verbindet. Doch ein überraschender Fakt überrascht viele: Fast 40 Prozent der Gebäude in Manhattan entsprechen nicht mehr den heutigen Bau- und Zonenvorschriften und könnten daher heute nicht mehr errichtet werden. Diese Tatsache wirft ein Schlaglicht auf die komplexe und bisweilen widersprüchliche Rolle von städtischer Planung und Regulierung in einer der dichtest besiedelten Metropolen der Welt. Die Geschichte der New Yorker Bauvorschriften Die Grundlage für viele dieser Restriktionen geht zurück auf den 1916 eingeführten New Yorker Zonenplan. Er war der erste seiner Art in den Vereinigten Staaten und wurde damals als revolutionärer Schritt angesehen, der die Lebensqualität in einer wachsenden Großstadt verbessern sollte.
Als New York damals von den wuchtigen, unregulierten Wolkenkratzern und den unhygienischen, überfüllten Mietskasernen der Vergangenheit heimgesucht wurde, brauchte es Regeln, die für mehr Ordnung, Luft und Licht sorgten. Das Resultat war ein Zonenplan, der Auflagen für Gebäudehöhe, Dichte, Abstandsflächen und Nutzung festlegte. So entstand unter anderem die für Manhattan typische Zickzack-Form vieler Hochhäuser, die sogenannten Rücksprünge oder Setbacks. Diese sollten verhindern, dass Gebäude direkt bis zur Straßenkante unverhältnismäßig in die Höhe schießen, wodurch Straßen und Plätze im Schatten verschwinden würden. Diese Regelung sorgte auch für die ästhetische Gestaltung, die viele historische Gebäude prägt und die heute oft als charakteristisch für New York gilt.
Moderne Anforderungen, alte Bauwerke Doch seit über einhundert Jahren haben sich die Bedürfnisse der Stadt gewandelt. Aktuelle Bauvorschriften zielen darauf ab, gesündere, nachhaltigere und ressourcenschonendere Gebäude zu fördern. Gleichzeitig hat sich die Bevölkerung vervielfacht, was einen enormen Druck auf den Wohnungsmarkt und die Infrastruktur erzeugt. Das hochkomplexe Regelwerk ist seither mehrfach überarbeitet worden, zuletzt unter der Verwaltung von Bürgermeister Bill de Blasio, der einen Stadtplan durchsetzte, der günstigere und schlankere Baustrukturen ermöglichen soll. Trotz dieser Anpassungen sind viele historische Gebäude, die das Stadtbild prägen, heute schlichtweg nicht mehr genehmigungsfähig.
Eine Untersuchung von rund 43.000 Gebäuden Manhattans zeigt, dass etwa 40 Prozent von ihnen in mindestens einem zentralen Aspekt gegen die aktuellen Zonenvorschriften verstoßen. Das kann eine zu große Baumasse, eine zu hohe Anzahl von Wohneinheiten, eine nicht zulässige Nutzung oder einfach eine Überschreitung der aktuell erlaubten Gebäudehöhe sein. Beispielsweise wäre das historische Gebäude 19 Jones Street im Greenwich Village, ein so genannter Dumbbell-Tenement aus dem Jahr 1910, heute deutlich kleiner. Ursprünglich bot es 24 Wohnungen.
Heute dürften hier aber lediglich acht Einheiten entstehen, wenn man die heutigen Vorschriften zugrunde legt. Die Wohnungen kämen also mit mehr Platz aus, aber die Gesamtzahl an verfügbaren Wohneinheiten würde stark sinken. Dieses Beispiel zeigt eindrucksvoll, wie Bauvorschriften zur Entstehung von weniger, dafür aber größeren und häufig teureren Wohnungen beitragen können und welchen Einfluss dies auf die Verknappung und Verteuerung des Wohnraums in Manhattan hat. Ein anderes Beispiel ist das luxuriöse Gebäude 720 Park Avenue auf der Upper East Side. Diese 1928 erbaute Wohnanlage mit 17 Stockwerken und lediglich 29 luxuriösen Wohnungen stand einst für Prunk und Exklusivität.
Heute wären ein Gebäude dieser Größe und Höhe angesichts der strikteren Regelungen bei Gebäudehöhe und Rücksprünge – Setbacks – nicht mehr zulässig. Heutige Vorschriften begrenzen die Höhe auf etwa 60 Fuß und vorschreiben, dass Baumaßnahmen ab einer bestimmten Höhe zurückgesetzt sein müssen, um Straßen und Nachbargebäude nicht zu stark zu beschatten oder zu beeinträchtigen. Die Folge ist, dass viele der historisch bedeutenden Gebäude aus vorherigen Zeiten nicht mehr im Einklang mit den aktuellen städtischen Anforderungen stehen. Städtebauliche und soziale Auswirkungen Die Tatsache, dass so viele Gebäude heute nicht neu gebaut werden dürften, wirft nicht nur Fragen der Architektur und des Denkmalschutzes auf, sondern vor allem auch Fragen der sozialen Gerechtigkeit und der Entwicklung des Wohnungsmarktes. Denn die strengen Regelungen zum Beispiel bei der maximalen Dichte und der erlaubten Bauweise erschweren die Schaffung von neuem, bezahlbaren Wohnraum in einer Stadt mit weiterhin steigenden Mieten.
Die Beschränkungen können dazu führen, dass trotz hoher Nachfrage weniger Wohnungen zur Verfügung stehen, was wiederum den Preisdruck erhöht. Darüber hinaus gestaltet sich die Implementierung neuer Bauvorhaben oft kompliziert und zeitaufwendig, weil Bauherren häufig mit den umfangreichen und verschachtelten Vorschriften kämpfen müssen. Der aktuelle städtische Bauplan wird als zu komplex und intransparent wahrgenommen. So fordert etwa die Municipal Art Society of New York mehr Transparenz und eine grundlegende Überarbeitung des Zonenplans, um ihn verständlicher und an die Bedürfnisse der Bevölkerung adaptierter zu gestalten. Architektonische Vielfalt und Erhalt historischen Erbes Interessanterweise trägt der Umstand, dass die Bauvorschriften im Laufe der Jahrzehnte immer restriktiver geworden sind, auch zum Schutz zahlreicher historischer Gebäude bei.
Denn viele ältere Gebäude profitieren von einer sogenannten Nichtkonformitätsklausel. Sie erlaubt es ihnen, weiterhin zu existieren, selbst wenn sie heutigen Standards nicht entsprechen. Dies hat eine gewisse architektonische Vielfalt zur Folge, die Maschinenhäuser aus verschiedenen Epochen vereint. Dennoch gibt es auch darunter Bauten, die den Ansprüchen moderner Nutzung nicht mehr genügen. Das sogenannte Zelten von Gebäuden ist eine Strategie einiger Investoren, die den unteren Teil älterer Gebäudestrukturen erhalten und nur die oberen Stockwerke abreißen und neu errichten.
Das erlaubt ihnen, die ursprüngliche Gebäudefläche für zukünftige Bauvorhaben zu sichern, ohne die gesamten Vorschriften neu durchlaufen zu müssen. Diese Vorgehensweise sorgt zusätzlich für Debatten darüber, in welchem Maße die Stadt ihre historische Identität bewahren oder moderne Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit durchsetzen sollte. Ausblick und mögliche Lösungsansätze Die Herausforderung für Manhattan und ganz New York City liegt darin, eine Balance zu finden. Einerseits sollen die Anforderungen an lebenswerten, gesunden und nachhaltigen Wohnraum erfüllt werden. Andererseits gilt es, den einzigartigen urbanen Charakter und die architektonischen Schätze zu bewahren.
Oberste Priorität hat zudem die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, was mit den historisch bedingten und zum Teil strengen Bauvorschriften erschwert wird. Innovative Lösungsansätze könnten hierbei in einer Vereinfachung und Modernisierung des Zonencodes bestehen. Ein transparenter und leichter verständlicher Regelkatalog könnte dazu beitragen, die Planungs- und Bauprozesse zu beschleunigen und Investitionen zu fördern. Zudem bieten flexible Nutzungs- und Bauvorschriften mehr Spielräume, um auf dem knappen Raum der Stadt dringend benötigten Wohnraum varianzreich und kosteneffizient zu schaffen. Ebenfalls diskutiert wird, inwieweit historische Gebäude durch behutsame Sanierungen besser an heutige Standards angepasst werden können, ohne ihren Charakter zu verlieren.
Gleichzeitig könnten neue Stadtentwicklungsprojekte mit Blick auf Dichte, Höhe und Nutzung so gestaltet werden, dass sie sich harmonisch ins Stadtbild einfügen. Fazit Manhattans bauliches Erbe ist ein faszinierender Spiegel der wechselnden gesellschaftlichen, sozialen und planerischen Anforderungen über mehr als ein Jahrhundert. Dass fast die Hälfte der bestehenden Bebauung heute nicht neu gebaut werden könnte, verdeutlicht die komplexen Spannungen zwischen Erhalt und Erneuerung, zwischen Sozialverträglichkeit und Architektur, zwischen Tradition und Innovation. Um die Zukunft der Stadt erfolgreich zu gestalten, wird es notwendig sein, die Bauvorschriften kritisch zu überprüfen, den Spagat zwischen Bewahrung und Entwicklung besser zu meistern und die Herausforderungen eines boomenden urbanen Lebensraums kreativ zu adressieren.