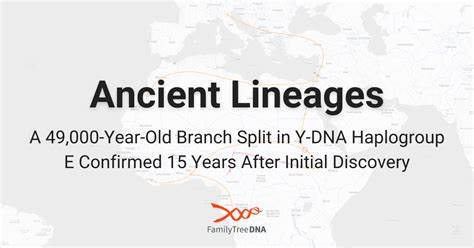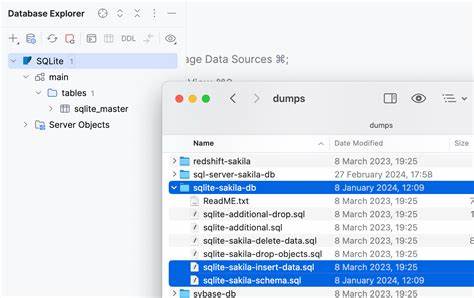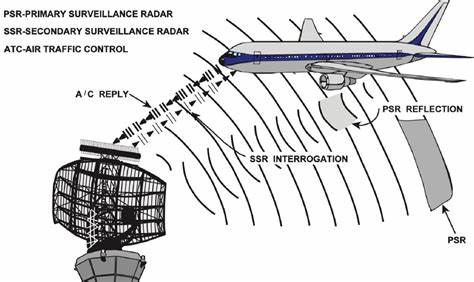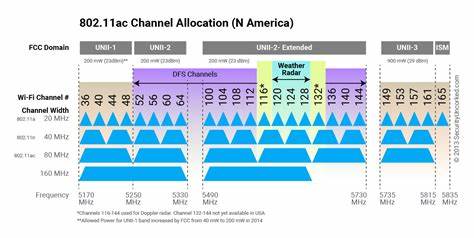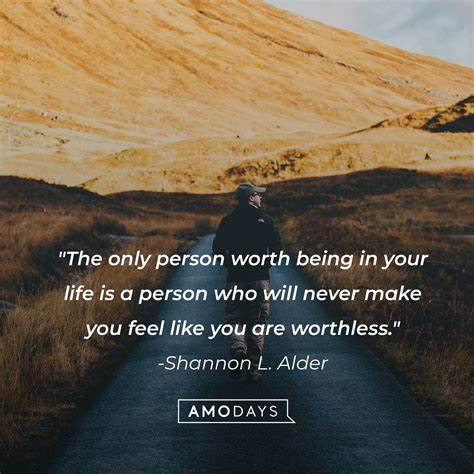Die Sahara gilt heute als eine der unwirtlichsten Wüstenregionen der Erde, geprägt von extremen Trockenperioden und spärlicher Vegetation. Doch vor rund 14.500 bis 5.000 Jahren, während des sogenannten Afrikanischen Humiden Zeitraums, war die Sahara eine grüne Savanne mit zahlreichen Wasserstellen und einem vielfältigen Ökosystem. Diese sogenannte Grüne Sahara bot ideale Lebensbedingungen für frühe menschliche Gemeinschaften, die dort jagten, sammelten und erstmals domestizierte Tiere hielten.
Trotz zahlreicher archäologischer Funde war das genetische Bild der damaligen Bewohner bislang unklar – eine Herausforderung, die sich durch die schwierigen klimatischen Bedingungen und die schlechte Erhaltung von DNA in der Region erklärt. Erst jüngst gelang es einem Forscherteam um Nada Salem und Marieke S. van de Loosdrecht vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, prähistorische Genome von zwei etwa 7.000 Jahre alten Frauen aus dem Takarkori-Felsengrab in Libyen zu analysieren. Diese Proben stammen aus einer Zeit, in der pastoralistische Lebensweisen in der zentralen Sahara vorherrschten, und stellen die ersten vollständigen genomweiten Daten von Menschen dieser Ära aus der Grünen Sahara dar.
Ihre genetischen Profile öffnen ein neues Fenster in die Menschheitsgeschichte Nordafrikas und stellen vorhandene Annahmen zur Ausbreitung von Kultur und Genen in Frage. Das herausragende Ergebnis dieser Studie ist der Nachweis einer bislang unbekannten, tiefgreifend divergenten nordafrikanischen genetischen Linie, die sich etwa zur selben Zeit wie die Vorfahren der heutigen außerhalb Afrikas lebenden Menschen von südafrikanischen Populationen abgespalten hat. Im Gegensatz zu vielen anderen Populationen besitzt diese Linie nur äußerst geringe Anteile an Neandertaler-DNA, was darauf hindeutet, dass ihre Vorfahren über Jahrtausende hinweg relativ isoliert lebten. Zudem zeigen die Analyseergebnisse eine enge genetische Verwandtschaft zu den rund 15.000 Jahre alten foragerischen Bewohnern aus der Höhle von Taforalt in Marokko, die mit der Iberomaurusischen Steinzeitindustrie in Verbindung gebracht werden.
Die ausgeprägte genetische Nähe zwischen den Individuen von Takarkori und jenen aus Taforalt erlaubt es, die Existenz einer langlebigen, stabilen Bevölkerungslinie in Nordafrika anzunehmen, die schon vor Beginn des Afrika-Humiden Zeitraums bestand. Bemerkenswert ist zudem, dass trotz klimatischer Bedingungen, die den Wandel des Landes in eine grüne und wasserreiche Zone ermöglichten, kaum genetischer Austausch mit den sub-Saharischen Populationen nachgewiesen werden konnte. Dieser genfreie Austausch über den Sahara-Korridor während des AHP scheint deutlich eingeschränkt gewesen zu sein, was umso überraschender ist, weil archäologische Befunde eine expansionistische Ausbreitung pastoralistischer Gesellschaften südlich und nördlich der Sahara nahelegen. Wissenschaftlich betrachtet unterstützt die Analyse die These, dass die Ausbreitung der Pastoralisierung in der Sahara primär durch kulturellen Austausch statt durch großflächige Bevölkerungswanderungen erfolgte. Die wenigen Levante-Mischanteile, welche im Erbgut der Takarkori-Personen nachweisbar sind, deuten auf kleinere Kontakte und Geneinschleusungen hin, jedoch ist das überragende Erbgut ein durch lange Isolation bewahrter nordafrikanischer Stamm.
Dieses Muster beeindruckt vor allem in der Betrachtung der Neandertaler-Anteile: Wo Populationen außerhalb Afrikas einen deutlich höheren Anteil erbten, weist Takarkori eine zehnmal geringere Neandertaler DNA auf als andere Gruppen wie equivalent neolithische Bevölkerungen im Nahen Osten. Die mitochondriale DNA (mtDNA), die ausschließlich über die mütterliche Linie vererbt wird, unterstützt diese Erkenntnisse und zeigt, dass die Takarkori-Individuen zur basalsten Linie des Haplogruppens N gehören. Diese Linie zählt zu den tiefsten mtDNA-Verzweigungen außerhalb des subsaharischen Afrikas und wurde vor mehr als 60.000 Jahren datiert, was einen weiteren Beleg für die lange Geschichte dieser Bevölkerungsgruppe in der Region darstellt. Die archäologische Bedeutung der Fundstelle Takarkori ist ebenfalls nicht zu unterschätzen.
Der Felsenschutz diente über Jahrtausende als Lebens- und Begräbnisstätte für lokale Gemeinschaften, deren materielle Kulturen, wie beispielsweise Keramik, Jagdausrüstung und Werkzeuge, eine kulturelle Kontinuität und Austausch von Wissen dokumentieren. Die genetischen Daten fügen nun eine neue Dimension hinzu, die tiefgreifende Bevölkerungsstrukturen enthüllt, von denen man lange nichts wusste. Die gesellschaftlichen und umweltbedingten Bedingungen in der Grünen Sahara führten zu einer Fragmentierung der Lebensräume, was sowohl ökologische als auch kulturelle Barrieren innerhalb der Bevölkerung schuf. Dies erklärt teilweise die genetische Differenzierung zwischen Nordafrika und dem subsaharischen Raum, trotz wiederholter Phasen erhöhter Feuchtigkeit, die für potenzielle Wanderungen und Vermischungen günstig gewesen wären. Zusätzlich sorgten soziale Faktoren und kulturelle Präferenzen vermutlich dafür, dass es zu einer selektiven Annahme von Innovationen wie der Viehzucht kam, ohne dass dies immer mit großen genetischen Vermischungen einherging.
Insgesamt weist die Studie von Salem, van de Loosdrecht und Kolleginnen auf eine komplexe Bevölkerungsstruktur hin, in der tief verwurzelte nordafrikanische Vorfahren eine zentrale Rolle spielen. Im Gegensatz zu früheren Modellen, die die afrikanische Komponente in den Iberomaurusiern größtenteils als sub-saharisch interpretierten, wird diese Komponente nun präziser als eine autochthone nordafrikanische Linie herausgearbeitet. Für die Zukunft versprechen sich die Wissenschaftler eine noch detailliertere Rekonstruktion der menschlichen Besiedelungsgeschichte Nordafrikas durch weitere genetische Untersuchungen. Mit sinkenden Sequenzierungskosten und verbesserten Methoden könnten neue Proben aus bisher schwer zugänglichen Regionen der Sahara neue Erkenntnisse liefern. So besteht die Aussicht, komplexe Muster von Migration, Isolation und kultureller Weitergabe noch besser zu verstehen und die Rolle der Grünen Sahara als eine historische Brücke, aber auch als Barriere menschlicher Genflüsse sowie kultureller Entwicklungen erklären zu können.