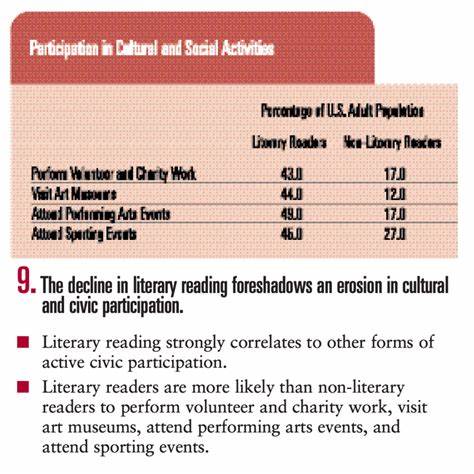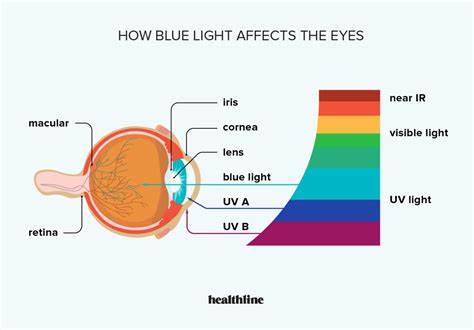Im Zeitalter der Digitalisierung und Kryptowährungen versprechen Bitcoin und Co. nicht nur hohe Renditen, sondern eröffnen auch Risiken, die viele Anleger kaum abschätzen können. Ein aktueller Fall aus British Columbia (B.C.), Kanada, macht deutlich, wie eine vermeintlich vielversprechende Investition in eine Bitcoin-bezogene Transaktion in einem juristischen Streit und finanziellen Ruin enden kann.
Dabei stehen zwei Männer im Zentrum einer Auseinandersetzung, die weit über das gewohnte Maß klassischer Vertragsstreitigkeiten hinausgeht und zugleich ein Lehrstück über die volatilen und oft intransparenten Seiten der Kryptowelt ist. Der Kern des Streits dreht sich um ein Darlehen in Bitcoin, das 2021 zwischen Daniel Tambosso und Hung Nguyen ausgehandelt wurde. Nguyen, ein Immobilienmakler aus Kelowna, lieh Tambosso insgesamt 22 Bitcoins im Wert von über einer Million kanadischen Dollar – ein Betrag, der für Nguyen seine gesamten persönlichen Ersparnisse darstellte. Das Darlehen sollte lediglich 48 Stunden laufen, doch Tambosso kam seiner Rückzahlungsverpflichtung nicht nach. Die Folge war eine gerichtliche Auseinandersetzung vor dem Obersten Gerichtshof von British Columbia, der ein klares Urteil fällte: Tambosso wurde verpflichtet, dem Kreditgeber den Gegenwert der Bitcoins in bar zurückzuzahlen.
Das Besondere an diesem Fall liegt nicht nur in der hohen Summe, sondern in dem Kontext, in dem das Darlehen gewährt wurde. Tambosso behauptet, dass er Opfer eines ausgeklügelten Ponzi-Schemas geworden sei, bei dem manipulierte Blockchain-Wallets zum Einsatz kamen. Er habe versprochen, verlorene Bitcoins mithilfe spezieller Sicherheitssoftware zurückzugewinnen, die angeblich von Satoshi Nakamoto, dem mysteriösen Schöpfer von Bitcoin, entwickelt wurde. Immer wieder verlangte die Software weitere Bitcoin-Zahlungen, die Tambosso ohne ausreichende Sicherheiten mit dem Geld von Nguyen begleichen wollte – in der Hoffnung auf eine lukrative Rückzahlung in Form von Tausenden Bitcoins, wie ihm versprochen wurde. Die strategische Erwähnung von Satoshi Nakamoto verlieh der Geschichte eine besondere Glaubwürdigkeit, da der Name in der Kryptowährungswelt häufig mit Innovation und Vertrauen verbunden ist.
Diese Verbindung sorgte letztlich dafür, dass Nguyen dem Angebot glaubte und das Darlehen gewährte. Doch die Realität zeichnete sich bald als deutlich komplexer und riskanter ab: Die Software konnte nicht die versprochenen Mittel freischalten, und die beigesteuerten Beträge wurden immer größer, ohne dass eine Aussicht auf Erfolg bestand. Die Gerichtsverhandlung deckte dabei einen weiteren entscheidenden Punkt auf: Trotz aller digitalen und technischen Besonderheiten spielte der Fall für die Richter vor allem auf der Ebene des klassischen Vertragsrechts. Die Vereinbarung zwischen den Parteien war klar: Tambosso sollte die geliehenen Bitcoins unabhängig vom Erfolg der Rückgewinnungsaktion innerhalb von 48 Stunden zurückzahlen. Somit blieb für das Gericht die Frage der Weigerung oder Unfähigkeit zur Rückzahlung ein einfaches Rechtsproblem und keine technische Frage der Blockchain-Sicherheit.
Nguyen dokumentierte in seinen Gerichtsaussagen seine jahrelange Investitionsgeschichte in Kryptowährungen, die 2017 mit kleinen Beträgen begann und sich bis 2021 auf eine beeindruckende Investitionssumme von rund 1,18 Millionen kanadischen Dollar steigerte. Um dieses Portfolio auszubauen, nahm er einen Kredit auf und investierte auch sein gesamtes Erspartes. Die immensen Summen, welche nun in dem Streit auf dem Spiel stehen, machen deutlich, welches Ausmaß das finanzielle Risiko bei Kryptowährung haben kann. Tambosso hingegen schilderte seinen Verdruss und die psychischen Belastungen, die mit der wiederholten Zahlungsforderung einhergingen. Er verglich die erlebte Situation mit dem Szenario der Filmsaga „SAW“, in der die Protagonisten Entscheidungen unter extremem Druck treffen müssen, ohne zu wissen, ob das Risiko überhaupt zu rehabilitierenden Ergebnissen führt.
Diese Analogie unterstreicht die hohe emotionale Beanspruchung und die Unsicherheit, die viele Anleger in der verwirrenden Welt der Kryptowährungen verspüren. Versuche von Tambosso, den Rechtsstreit und die Öffentlichkeit fernzuhalten, blieben erfolglos. Das Gericht betonte, dass der Fall trotz der komplexen technischen Details keinen Sonderstatus beanspruchen könne. Die Verantwortlichkeiten aus dem Darlehensvertrag stünden im Vordergrund, somit war die gerichtliche Entscheidung eine klare Abwendung von einem Verzicht auf Rückzahlung aufgrund vermeintlicher Betrugsfälle durch Dritte oder technologische Probleme. Für Nguyen hat die gerichtliche Entscheidung eine bittersüße Komponente.
Zwar wurde entschieden, dass ihm das Geld zusteht, doch stehen ihm erhebliche Belastungen bevor. Er muss nach eigenen Angaben weiterhin einen Kredit abbezahlen und seine finanzielle Situation bleibt angespannt. Der Fall zeigt, wie auch Investoren, die vermeintlich auf der sicheren Seite sind, durch riskante Engagements in der Kryptowelt in existenzbedrohende Situationen geraten können. Der Fall zwischen Tambosso und Nguyen wirft ein Schlaglicht auf die Risiken, die mit der Investition in Kryptowährungen verbunden sind. Die Blockchain-Technologie als neuartiges Finanzinstrument bietet Chancen, doch auch Gefahren wie Betrug, undurchsichtige Geschäftsmodelle und rechtliche Unsicherheiten.
Gerade die Anonymität und die Komplexität der Technologie erhöhen die Risiken für alle Beteiligten. Vor diesem Hintergrund fordern Rechtsexperten und Finanzberater verstärkt Aufklärung und Schutzmechanismen für Anleger. Während der Bitcoin-Markt weiterhin boomt, ist die Zahl der Betrugsfälle und ähnlicher Streitigkeiten steigend. Häufig wird dabei deutlich, dass traditionelles Vertragsrecht und moderne Finanzwelt zusammenwirken müssen, um solche Fälle zu lösen und künftige ähnliche Fälle zu vermeiden. Darüber hinaus verdeutlicht der Fall den psychischen Druck, der mit hohen finanziellen Verpflichtungen in einem volatilen Marktsegment einhergeht.