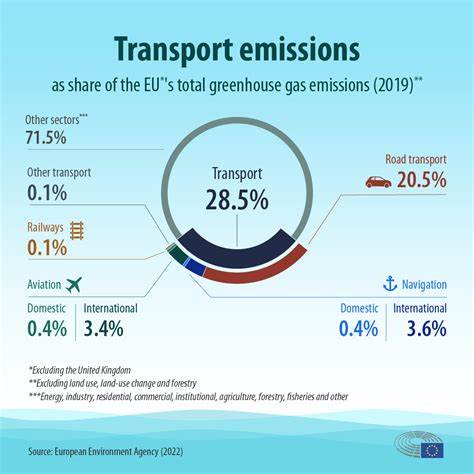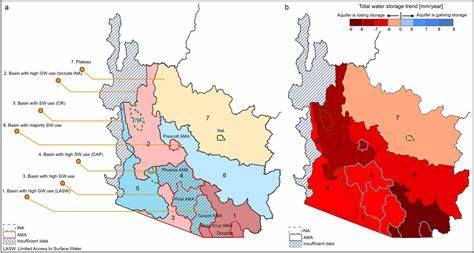Die Technologiebranche ist geprägt von großen Firmenübernahmen, bei denen populäre Apps von etablierten Unternehmen aufgekauft werden. Häufig führt dies zu Unsicherheiten bei den Nutzern: Wird die App weitergeführt? Geht der Funktionsumfang verloren oder wird das Angebot komplett eingestellt? Apple jedoch begeistert durch eine konsistente und meist userfreundliche Herangehensweise, wenn das Unternehmen Apps übernimmt. Seit Jahren zeigt sich, dass Apple mit seinen Übernahmen das Ziel verfolgt, die Nutzererfahrung zu verbessern und den Wert der jeweiligen App sinnvoll in das eigene Ökosystem zu integrieren. Ein Blick auf vergangene Beispiele offenbart, dass Apple keineswegs seine übernommenen Apps vernachlässigt oder aus rein strategischem Wettbewerbsgedanken einstampft. Vielmehr bemüht sich das Unternehmen, sowohl die Nutzer als auch die Entwickler zufrieden zu stellen.
Die Übernahme von Shazam im Jahr 2018 ist eines der bekanntesten Beispiele für Apples erfolgreiche Integration einer externen App. Shazam, eine App, die Musikstücke in Echtzeit identifiziert, wurde zunächst als eigenständige Anwendung fortgesetzt – inklusive einer Version für Android, was für Apple eher ungewöhnlich ist. Die Kernfunktionalitäten von Shazam wurden nahtlos in Siri eingebettet, Apples Sprachassistent, wodurch die Musik-Erkennungsfunktion für Millionen von iPhone-Nutzern direkt zugänglich wurde. Dabei kam es nicht zur Abschaltung der Einzel-App, was zeigt, dass Apple bestehende Nutzer nicht verlieren möchte und Mehrwert auf mehreren Kanälen erzeugt. Shazam bleibt damit ein Beispiel, bei dem Übernahme und Weiterentwicklung Hand in Hand gehen, ohne Kompromisse bei Bedienbarkeit und Verfügbarkeit einzugehen.
Apple verfolgt dabei unterschiedliche Strategien, je nach Art der App und den langfristigen Zielen. Eine Möglichkeit ist, die App als eigenständiges Produkt bestehen zu lassen und unter eigener Regie weiterzuentwickeln. Dies war zum Beispiel bei Logic Pro, der professionellen Musikproduktionssoftware, der Fall. Logic wurde 2002 durch den Kauf des Unternehmens Emagic Teil von Apples Portfolio. Seitdem wurde die App kontinuierlich verbessert, ohne dass Apple die Marke oder die eigenständige Software durch eine vollständige Integration in andere Tools ersetzte.
Auch FileMaker, eine etablierte Datenbanksoftware, blieb trotz Übernahme als eigenständiges Produkt erhalten. So bewahrt Apple die Identität und Stärken der Apps, auf die Nutzer Wert legen, und unterstützt sie weiterhin mit eigenen Ressourcen. Eine andere Herangehensweise besteht darin, die Technologie einer App zu nutzen, um sie direkt in das Betriebssystem zu integrieren und das eigenständige Produkt einzustellen. Beispiele hierfür sind Siri und Dark Sky. Siri begann ursprünglich als separate App, die Apple kurz nach ihrem Launch 2010 übernahm.
Mit dem iPhone 4S wurde Siri dann als Systemfunktion implementiert und die App vom Markt genommen. Diese Verlagerung in die Systemumgebung verbesserte den Zugang und die Nutzerfreundlichkeit erheblich, da Siri zu einem integralen Bestandteil des iOS-Erlebnisses wurde. Ähnlich verhielt es sich mit Dark Sky, einem Wetterdienst mit einer hoch anerkannten Vorhersagetechnologie. Apple erwarb Dark Sky, betrieb die App vorübergehend weiter, um Bestandskunden nicht zu verprellen, beendete dann jedoch den separaten Betrieb und integrierte die Kerntechnologien in die eigene Wetter-App und die Entwicklerplattformen. Auch wenn sich eingefleischte Dark Sky-Fans nach der gewohnten App sehnen, kann man Apples Vorgehen als vorbildlich einstufen, da die Technologie erhalten blieb und einer breiteren Nutzerbasis zugutekommt.
Ein seltener Fall, der in der Tech-Welt jedoch oft vorkommt, ist die sogenannte „Acquihire“, bei der ein Unternehmen hauptsächlich Mitarbeiter kauft, um das Talentepotenzial zu sichern, während die Produkte stillgelegt werden. Apple hat hier einen anderen Ruf. Zwar gibt es Fälle, in denen talentierte Entwickler zu Apple wechselten und ihre bisherigen Projekte nicht fortführten, doch es gibt kaum Beispiele, bei denen eine etablierte und populäre App gezielt eingestellt wurde, um ausschließlich die Entwickler ins Haus zu holen. Apple legt großen Wert auf die Qualität und Langlebigkeit einzelner Apps, was eine ungewöhnlich positive Ausnahme in der Branche darstellt. Nicht minder wichtig ist Apples Vermeidung von Übernahmen, die ausschließlich auf das Ausschalten von Konkurrenz abzielen.
Anders als manche Mitbewerber kauft Apple selten Apps, nur um diese zu schließen und Marktabdeckungen auszudünnen. Gerade bei jüngsten Übernahmen, zum Beispiel der apps Pixelmator und Photomator, die sich auf Bildbearbeitung und Fotografie spezialisieren, ist nicht erkennbar, dass Apple Wettbewerb ausschalten will. Vielmehr positioniert sich Apple durch solche Käufe, um sein Portfolio sinnvoll zu erweitern und von der langjährigen Expertise der Entwickler zu profitieren, ohne die Nutzer zu verprellen. Dabei bleiben die Apps – zumindest vorerst – eigenständig und werden weitergeführt. Der Umgang mit Pixelmator zeigt exemplarisch, wie Apple durchdacht vorgeht.
Pixelmator gilt als eine ausgesprochen technisch versierte und beliebte App für professionelle Bildbearbeitung, die auf Macs und iPads läuft. Apple hat seit langem kein eigenes Bitmap-basiertes Bildbearbeitungstool von ähnlichem Format mehr veröffentlicht. Mit der Akquise positioniert sich das Unternehmen deshalb, um Pixelmator möglicherweise als eigene „Pro-App“ neben Final Cut Pro und Logic Pro zu etablieren. Diese Strategie zeigt, dass Apple über reine Übernahme hinaus denkt und Apps, die sich bewährt haben, langfristig als wichtige Bausteine des eigenen Produktangebots sieht. Anders verhält es sich ggf.
bei Photomator, das sich auf Fotobearbeitung spezialisiert hat und gegen starke Konkurrenten wie Adobe Lightroom antritt. Apple hatte vor Jahren mit Aperture schon einmal einen Schritt in den Bereich Fotomanagement und Bearbeitung unternommen, hat diese Sparte jedoch aufgegeben. Wie ernst Apple Photomators Weiterentwicklung nimmt, ist noch nicht ganz klar. Es ist vorstellbar, dass bestimmte Innovationen wie maschinelles Lernen zum Hochskalieren von Bildern in Apples Fotos-App und in Systemwerkzeugen eingebettet werden, während die eigenständige App weniger im Fokus steht. Diese Option passt zu Apples Praxis, innovative Technologien in systemweite Frameworks zu integrieren, wodurch viele Entwickler gleichermaßen profitieren.
Historisch betrachtet hat Apple zahlreiche wichtige Käufe getätigt, deren positive Auswirkungen heute unübersehbar sind. So wurde aus Beats durch die Übernahme 2014 die Grundlage von Apple Music, dem zentralen Streamingdienst des Unternehmens. iTunes, ursprünglich SoundJam MP, wurde nach der Übernahme komplett überarbeitet und zu einer der wichtigsten Musikverwaltungssoftware der Welt entwickelt. Selbst Final Cut Pro wurde erst durch die Akquisition eines noch nicht veröffentlichen Produktes von Macromedia zum Industriestandard der Videobearbeitung auf Apple-Plattformen. Nicht alle Übernahmen waren dauerhaft erfolgreich.
So wurde Shake, eine professionelle Software für Videoeffekte, nach der Übernahme eingestellt. Dennoch erkannte Apple einige der Funktionen und integrierte sie nach und nach in andere Programme wie Final Cut Pro. Auch TestFlight, eine Plattform zum Testen von Apps vor der Veröffentlichung, wurde übernommen und in das Apple-Ökosystem eingebunden, um Entwicklern optimale Voraussetzungen für das Beta-Testing zu bieten. Apple hat außerdem kleinere Unternehmen erworben, die Apple Maps stetig verbessern. So wurde beispielsweise der Nahverkehrs-App-Anbieter Embark übernommen, was dazu beitrug, die Transitfunktionen von Apple Maps erheblich zu erweitern.
Der Trend zeigt: Apple kauft gezielt Unternehmen, deren Technologie das eigene Produktangebot sinnvoll ergänzt. Die Branche kennt viele Beispiele, in denen Übernahmen die Nutzererfahrung verschlechtern – sei es durch Vernachlässigung, Umgestaltung oder das Einstellen bewährter Software. Apple dagegen achtet auf den Erhalt der Qualitätsmerkmale übernommener Apps. Das bedeutet nicht nur Service für die Kunden, sondern auch eine Wertschätzung der kreativen Arbeit der Entwickler. Gerade bei Pixelmator könnte diese Philosophie dazu führen, dass die App künftig als starkes Grafik- und Bildbearbeitungswerkzeug mit dem Apple-Branding und noch besserer Integration auftritt und somit eine echte Alternative zu etablierten Konkurrenten wie Adobe Photoshop darstellt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Apple in Sachen App-Übernahmen einen vorbildlichen Mittelweg verfolgt. Das Unternehmen bewertet jedes Projekt auf Grundlage seiner Marktstellung, Nutzerbasis und technologischem Potenzial. Es werden bewährte Apps erhalten, weiterentwickelt oder die dahinterstehenden Technologien in die Betriebssysteme integriert. Gleichzeitig vermeidet Apple strategische Ausschaltungen von Konkurrenzprodukten, was dem Nutzer zugutekommt. Diese Herangehensweise stärkt das Vertrauen der Anwender, die wissen, dass eine Übernahme durch Apple meist nichts Gutes verheißt – nämlich Qualität, Kontinuität und Innovation.
In einer sich rasch ändernden digitalen Landschaft, in der Apps ständig neu erfunden oder plötzlich verschwunden sind, ist Apples konsequenter Einsatz für die Pflege und Modernisierung übernommener Apps ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal. Nutzer, Entwickler und Marktbeobachter können sich darauf verlassen, dass Apple Werte wie Qualität und Nutzerorientierung nicht nur bei eigenen Produkten, sondern auch bei übernommenen Apps hochhält. Dieses nachhaltige Engagement trägt erheblich zur Stärkung von Apples gesamtem Ökosystem und zur Zufriedenheit seiner weltweit Millionen Anwender bei.