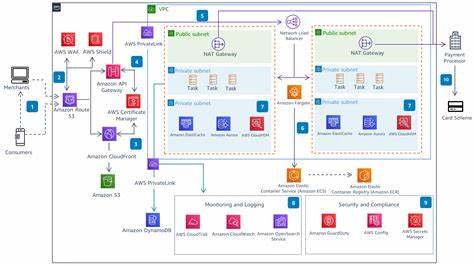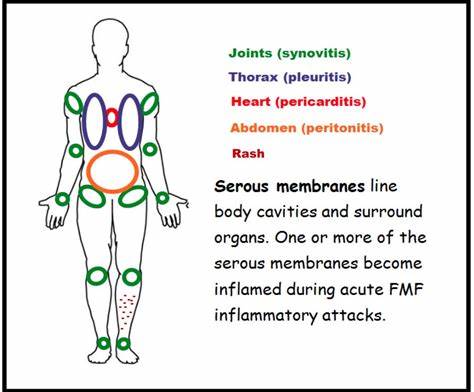In der digitalen Ära ist der Umgang mit personenbezogenen Daten zu einem der zentralen Themen gesellschaftlicher Diskussionen geworden. Besonders sensibel wird es, wenn staatliche Institutionen Daten von Bürgerinnen und Bürgern erheben und verarbeiten. Skandinavische Länder wie Dänemark, Schweden und Norwegen gelten in der Digitalisierung staatlicher Dienstleistungen als Vorreiter. Dennoch offenbart eine aktuelle Untersuchung, dass auf den kommunalen Websites dieser Länder eine Vielzahl kommerzieller Drittanbieter-Tracker aktiv sind, die Daten der Nutzer*innen sammeln. Diese Praxis wirft dringende Fragen auf: Inwieweit ist die Datenerfassung durch Dritte auf Regierungsseiten vereinbar mit dem Prinzip der universellen Zugänglichkeit? Welche Kosten entstehen für die Bürgerinnen und Bürger durch die sogenannten „Daten als Zahlung“-Mechanismen? Und wie kann die staatliche Transparenz in digitalen Dienstleistungen gewährleistet werden? Die Untersuchung, die zwischen 2007 und 2023 auf 745 kommunalen Webseiten durchgeführt wurde, zeigt, dass insgesamt 2.
761 Tracker registriert wurden. Besonders alarmierend ist dabei die Dominanz von Tracker-Technologien großer Technologiekonzerne wie Alphabet (Google) und Meta (Facebook). Diese sammeln die Daten nicht ausschließlich zu Zwecken der Optimierung staatlicher Dienste, sondern primär für Werbezwecke, was einen offenen Interessenkonflikt darstellt. Die Grundidee hinter der digitalen Öffnung staatlicher Angebote ist die Schaffung eines universellen Zugangs zu Dienstleistungen, der für alle Bürger*innen gleichermaßen gilt und nicht an versteckte Kosten oder Bedingungen gebunden ist. In diesem Kontext stellt der Einsatz kommerzieller Tracker eine verdeckte Form der Kostenübernahme seitens der Nutzer*innen dar, da Personen faktisch mit ihren Daten bezahlen, wenn sie digitale Regierungsdienste in Anspruch nehmen.
Dieses „Daten-als-Zahlung“-Modell steht im Widerspruch zum Anspruch eines solidarischen und transparenten Wohlfahrtsstaats, der auf Gleichheit und Datenschutz fußt. Die Einbindung Drittanbieter-Tracker auf staatlichen Webseiten wirft nicht nur ethische, sondern auch juristische Fragen auf. Datenschutzrechtliche Vorschriften wie die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verlangen Transparenz bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und das Erteilen von informierter Einwilligung. Doch öffentliche Websites müssen barrierefrei und einfach zugänglich bleiben – auf einer Ebene, die nicht durch komplexe Datenschutzhinweise und Einwilligungsmechanismen beeinträchtigt wird. Die Praxis zeigt jedoch, dass viele Nutzer*innen kaum nachvollziehen können, welche Daten erfasst werden und wofür diese verwendet werden.
Zudem führt die Überwachung auf kommunaler Ebene zu einer Fragmentierung der Datenschutzstandards: Je nach Kommune und eingesetzter Technik variieren die Datenschutzmaßnahmen und Transparenzberichte. Dies steht im Widerspruch zum skandinavischen Modell der universellen sozialstaatlichen Versorgung, das auf Gleichheit und sozialer Sicherheit basiert. Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Forschung, dass Regierungen den Einsatz kommerzieller Tracker auf kommunalen Webseiten grundsätzlich überdenken sollten. Ein transparenter Umgang mit den durch die Nutzer*innen verursachten „Kosten“ in Form von Daten ist unerlässlich. Dies könnte durch klar erkennbare Hinweise und offene Berichte über Datenverarbeitungsprozesse umgesetzt werden.
Noch konsequenter wäre ein grundsätzliches Verbot kommerzieller Tracking-Systeme auf staatlichen Websites. Alternativen bieten eigene, nicht-kommerzielle Analytiktools oder Tracking-Systeme, die ausschließlich der Verbesserung des Dienstleistungsangebots dienen, ohne personenbezogene Daten an externe Unternehmen weiterzugeben. Die Debatte um Drittanbieter-Tracker auf staatlichen Webseiten richtet sich nicht nur an Datenschutzbeauftragte und IT-Fachleute, sondern betrifft die gesamte Gesellschaft und politische Gestaltung. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in staatliche Institutionen und digitale Strukturen ist essenziell für eine erfolgreiche Digitalisierung. Wenn staatliche Websites als Datenquelle für kommerzielle Werbenetzwerke fungieren, gefährdet dies dieses Vertrauen und untergräbt demokratische Prinzipien.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die derzeitige Praxis der Nutzung von Drittanbieter-Trackern auf skandinavischen kommunalen Websites einen gravierenden Widerspruch zum universellen Anspruch der staatlichen Dienste darstellt. Die Erkenntnisse verdeutlichen den dringenden Handlungsbedarf, die datenschutzrechtlichen und ethischen Richtlinien auf dieses Feld anzuwenden und die digitale Infrastruktur so zu gestalten, dass sie die Rechte der Bürgerinnen und Bürger schützt. Transparenz, Verantwortlichkeit und die strikte Trennung von kommerziellen Interessen und staatlicher Dienstleistung müssen dabei Leitprinzipien sein. Nur so kann ein wirklich inklusive, vertrauenswürdige und datenschutzkonforme digitale Verwaltung entstehen, die den Herausforderungen der Gegenwart gerecht wird und die Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt stellt.