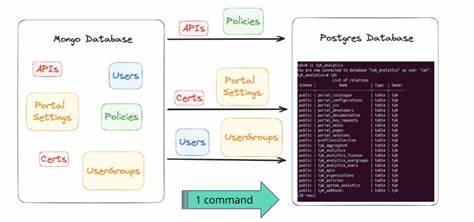Die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI), speziell im Bereich der generativen Modelle wie ChatGPT, wird häufig als revolutionär für Bildung und Lernen gefeiert. KI bietet scheinbar unvergleichlichen Komfort: Antworten und Erklärungen zu komplexen Fragestellungen erscheinen binnen Sekunden, was Lernprozesse sichtbar erleichtert. Doch genau hier liegt auch die Herausforderung. Ein Vergleich, der immer wieder aufkommt, verdeutlicht eine alarmierende Parallele: KI als „hyperverarbeitete Lebensmittel“ für das Lernen. Wie industriell gefertigte Snacks den Körper kurzfristig mit Energie versorgen, aber langfristig eher schaden, kann KI kurzfristig Wissen zugänglich machen, aber langfristig tiefgehendes Lernen beeinträchtigen.
Die metaphorische „Oreo-Kultur“ des Lernens illustriert den nicht zu unterschätzenden Einfluss von Bequemlichkeit auf den Lernprozess. Genau wie hyperverarbeitete Lebensmittel so zusammengestellt sind, dass sie unser Belohnungssystem im Gehirn aktivieren und uns nach mehr verlangen, weckt die Nutzung von KI oft den Wunsch nach immer schnellerer Lösung ohne anstrengende Denkarbeit. Lernende verwenden die KI, um fremde Antworten zu kopieren oder sich Aufgaben abnehmen zu lassen – was kurzfristig Erleichterung verschafft, aber das eigenständige und kritische Denken nicht fördert. Wissenschaftliche Studien belegen diese Theorie eindrucksvoll. Eine Untersuchung der Wharton School aus dem Jahr 2024 beispielsweise teilte 1.
000 Schüler in zwei Gruppen: Die erste erhielt generative KI zur Lernunterstützung, die zweite nicht. Die Ergebnislage zeigte überraschend, dass die KI-Nutzer bei späteren Tests schlechter abschnitten als diejenigen ohne Zugriff auf KI. Die Forscher schlossen daraus, dass eine übermäßige Verlass auf KI die Entwicklung grundlegender Problemlösefähigkeiten hemme. Diese Fähigkeiten sind für selbstständiges Denken und das Bestehen von Prüfungen unerlässlich. Die Ergebnisse werfen wichtige Fragen auf, wie KI sinnvoll in Lernprozesse integriert werden kann, ohne das tiefergehende Verstehen zu gefährden.
Um zu verstehen, warum KI zwar so verführerisch erscheint und dennoch mit Vorsicht betrachtet werden muss, lohnt sich ein Blick auf das menschliche Gehirn und wie Lernen wirklich funktioniert. Nobelpreisträger Daniel Kahneman beschrieb in seinem Buch „Thinking, Fast and Slow“ zwei Arten des Denkens: System 1, das schnell, intuitiv und automatisiert arbeitet, und System 2, das langsam, bewusst und anstrengend ist. Effektives Lernen verlangt die aktive Beteiligung von System 2, also eine bewusste Anstrengung, die neue Informationen kritisch verarbeitet und integriert. Die kurzfristige Nutzung von KI fördert jedoch oft nur das System-1-Denken. Die schnellen, vorgefertigten Antworten lösen die eigentliche kognitive Anstrengung ab – was am Ende eher zur oberflächlichen Vertrautheit mit Informationen, als zu echter Kompetenz führt.
Das Konzept der mentalen Anstrengung, oder „Frustration“ beim Lernen, ist ein weiterer Schlüssel zu nachhaltigem Lernerfolg. Wenn man eine neue Fähigkeit erlernen will, muss das Gehirn über „Widerstand“ und erklärbares Unbehagen hinwegkommen. Diese anspruchsvolle Phase signalisiert dem Lernen in System 2, dass echte Fortschritte möglich sind. So wie beim Fitnesstraining die Muskeln erst durch gezielte Belastung wachsen, benötigen unsere kognitiven Fähigkeiten herausfordernde Übungen. KI, die allzu einfach Lösungen liefert, kann diese geistige Belastung jedoch umgehen, was langfristig die „Stärke“ unseres Denkens untergräbt.
Lernende werden sozusagen zu „Passiv-Konsumenten“ des Wissens ohne eigenes aktives Engagement. Weiterhin beschränkt das menschliche Arbeitsgedächtnis unser Lernvermögen. Studien zeigen, dass wir nur wenige Informationseinheiten gleichzeitig effektiv verarbeiten können – meist um die vier. KI scheint hierbei Fluch und Segen zugleich zu sein: Sie kann Komplexität herunterbrechen und erleichtert somit die Informationsaufnahme, aber sie kann auch dazu verleiten, das Gehirn beim „chunking“ von Wissen zu entlasten. Ohne eigene mentale Anstrengung fehlt die Verknüpfung neuer Kenntnisse mit bereits vorhandenem Vorwissen.
Diese Verknüpfung ist jedoch zentral für langanhaltendes Lernen und den Aufbau eines belastbaren Wissensnetzwerks. Wie kann man also KI sinnvoll nutzen, ohne in die Falle des einfachen Konsums zu tappen? Lernen erfordert eine bewusste und aktive Herangehensweise, die den Geist fordert. Analoge Konzepte wie das „Zone of Proximal Development“ von Lev Vygotsky kommen hier ins Spiel. Dieses Modell beschreibt, dass optimaler Lernfortschritt nur in einem Bereich zwischen „zu einfach“ und „zu schwierig“ stattfindet. Innerhalb dieser Zone benötigen Lernende oft Unterstützung durch erfahrene Lehrkräfte oder Mentoren, ähnlich wie im Fitnessstudio ein Trainer individuell Anpassungen vornimmt.
KI kann nicht die Rolle eines aktiven Mentors übernehmen, der Lernfortschritte misst, motiviert und Selektionen vornimmt. Wichtiger noch, Lernen in Gemeinschaft fördert Motivation und vertieft den Lernprozess, denn Austausch und Diskussion stimulieren System 2 und führen zu nachhaltiger Verankerung von Wissen. Genauso wie es bei der Ernährung einen Unterschied macht, ob man gelegentlich Kekse genießt oder sich dauerhaft von Hochverarbeiteten Lebensmitteln ernährt, ist auch beim Lernen der Einsatz von KI zu differenzieren. Gelegentlich kann KI als Hilfsmittel sehr nützlich sein, zum Beispiel bei der gezielten Wiederholung, beim Aufbau von Lernplänen oder als Unterstützung bei der Ressourcenstrukturierung vor und nach dem Unterricht. Sie sollte jedoch nie die primäre Quelle sein, um sich Lerninhalte anzueignen.
KI ist daher am besten geeignet, wenn sie in die Phasen vor und nach der aktiven Lernarbeit eingebunden wird: Vorbereitend, um den eigenen Wissensstand besser zu verstehen, oder ergänzend, um Lernpläne zu erstellen, die den individuellen Bedarf abbilden und eine gezielte, anspruchsvolle Beschäftigung mit Themen sicherstellen. Wer langfristig erfolgreich lernen möchte, muss die mentalen Muskeln trainieren. Künstliche Intelligenz kann dabei als Personal Trainer fungieren, aber sie darf einem nicht die Anstrengung abnehmen. Ein effektiver Lernplan, der auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt ist, fördert gezielt den Einsatz von System 2. Der kognitive Aufwands sorgt für die Metamorphose von „unbekanntem“ in „bekanntes“ Wissen – dies ist es, was echtes Lernen ausmacht.
Beinharte Geduld und Motivation sind dafür unabdingbar. Strategien wie das sogenannte „retrieval practice“, also das aktive Herausholen von Wissen aus dem Gedächtnis, abwechslungsreiche Herausforderungen mit „interleaving“ sowie „spaced repetition“ sind wissenschaftlich belegt und sollten beim Lernen stets im Mittelpunkt stehen. KI-gestützte Tools können diese Methoden unterstützen, indem sie individuelle Fragenkataloge erstellen oder Wiederholungspläne anbieten. Der soziale Faktor darf nicht unterschätzt werden. Klassenzimmer, ob physisch oder virtuell, besitzen pädagogische Werkzeuge, die Interaktion und Feedback ermöglichen.
Der Austausch mit Lehrenden und Mitlernenden aktiviert System 2 in besonderem Maße und hilft, Lerninhalte zu verstehen, zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Die Einsamkeit des passiven Konsums von KI-generierten Antworten ersetzt keine interaktive Lernumgebung. Studien zu MOOCs (Massive Open Online Courses) belegen, dass ohne diese soziale und kognitive Unterstützung nur ein Bruchteil der Teilnehmenden den Kurs erfolgreich abschließt – meist sind dies ohnehin jene, die schon ein solides Fundament aufbauen konnten. Zugleich beeinflussen moderne Technologien und soziale Medien das Lernverhalten und besonders die Frustrationstoleranz. Ständige Verfügbarkeit von Informationen und Ablenkungen führt oft dazu, dass Lernende schnell vom Lernprozess ablassen, sobald dieser unangenehm oder fordernd wird.
Die Bereitschaft, die notwendige mentale Anstrengung auf sich zu nehmen, ist darum heute wichtiger denn je. Das Lernen mit KI sollte daher immer bewusst geplant sein und nicht der Versuchung erliegen, „Abkürzungen“ zu nutzen, die primär System 1 bedienen. Erfolgreiche Lernende durchlaufen dabei verschiedene mentale Zustände. Anfängliche Neugierde weckt das Interesse und aktiviert das Lernen. Wenn die Sache schwieriger wird, kommt die Phase der Frustration, die signalisiert, dass System 2 sich anstrengen muss – ein notwendiges Signal für Wachstum.
Mit fortschreitender Übung wird man zum „Jäger“, der zielgerichtet Wissen erarbeitet und Probleme löst. Letztlich führt diese Reise in den Zustand des „Flows“, in dem Wissen und Können ineinanderfließen und tiefes Verständnis entsteht. KI kann dabei als unterstützendes Werkzeug fungieren, aber niemals als Ersatz für diesen Prozess. Im beruflichen Umfeld unterscheidet sich der Einsatz von KI vom Lernen grundlegend. Dort wird KI oft eingesetzt, um bereits erworbene Fähigkeiten zu multiplizieren, Routinetätigkeiten zu automatisieren oder Kreativitätsprozesse zu unterstützen.
Dies führt zu Effizienzgewinnen und persönlichem Wachstum. Im Lernkontext ist die Sensibilität höher, da der Aufbau von Kompetenzen und Wissen selbst intensive Arbeit erfordert und nicht bloß eine Multiplikation bestehender Fähigkeiten ist. Wissensaneignung durch eigene Denkarbeit bleibt unablässig. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass KI bei der Wissensvermittlung sowohl große Chancen als auch Risiken birgt. Wer KI als attraktiven Snack beim Lernen betrachtet und sich dazu verleiten lässt, nur das schnelle Wissen zu konsumieren, riskiert langfristig den Verlust der Fähigkeit zum selbstständigen Denken.
Wahres Lernen ist kein einfacher Prozess, sondern eine mentale Anstrengung, die Frustrationen nicht scheut. KI kann als Coach und Assistent unterstützend wirken, wenn sie intelligent eingesetzt wird, um Lernpläne zu personalisieren und aktive kognitive Belastung zu fördern. Es braucht ein Bewusstsein für den eigenen Lernprozess, die richtige Anwendung von bewährten Lernstrategien und den sozialen Kontext, um die Vorteile der KI-Technologie für nachhaltigen Lernerfolg zu nutzen. Nur so kann die Zukunft des Lernens gestaltet werden: Mit der Kraft verantwortungsvoller Nutzung von KI, um die tiefsten Winkel unseres Verstandes zu aktivieren, statt sie abzuschalten. Die Lernenden sind somit gefordert, ihre mentalen Muskeln zu stärken, Frustration als Lerntreiber zu akzeptieren und KI als wertvolles Werkzeug – nicht als bequemen Ersatz – zu begreifen.
Letztlich gilt: Ein gelegentliches „Oreo“ beim Lernen ist erlaubt, doch das Alltagsmenü sollte aus echter, nährstoffreicher geistiger Kost bestehen, um nachhaltig gesund zu bleiben.



![Christie's – 21st Century Evening Sale – Wed May 14 25 [video]](/images/CF0D4379-5B8B-4361-8337-AF360B137A9C)