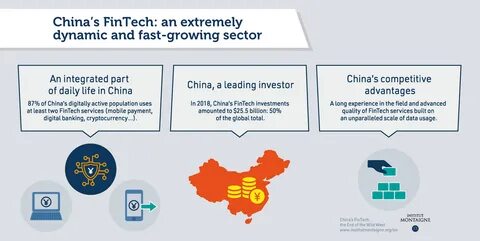Sammelklagen sind in den USA ein bedeutsames Instrument, mit dem Verbraucher gegen Unternehmen vorgehen können, die massenhaft Schaden verursachen – sei es durch Datenlecks, irreführende Geschäftspraktiken oder Produktmängel. Während solche Verfahren oft hunderttausende oder sogar Millionen Betroffene erreichen und immense Schadenersatzzahlungen zustande kommen, sind die Begleichung der Ansprüche und Auszahlung der Entschädigungen ein komplexer Prozess. Insbesondere die zunehmende Digitalisierung der Auszahlungen stellt sowohl Verbraucher als auch das Rechtssystem vor neue Herausforderungen. Dabei profitieren häufig private Beteiligungsgesellschaften (Private Equity) und mit ihnen verbundene Firmen in erheblichem Maße von den Geldern, die eigentlich für die Opfer bestimmt sind. Im Zentrum stehen digitale Prepaid-Karten, die als eine moderne und praktische Art der Auszahlung bei Sammelklagen eingeführt wurden.
Anstelle von traditionellen Schecks erhalten Geschädigte heutzutage oft eine elektronische Zahlungskarte, die vielfach in Online-Shops wie Amazon eingelöst werden kann. Die Bequemlichkeit ist unbestritten, doch Verbraucher berichten häufig von Verwirrung darüber, wie die geringen Beträge tatsächlich sinnvoll genutzt werden können. Zudem setzen viele dieser Karten bereits nach sechs Monaten Inaktivitätsgebühren an, die häufig mehrere Euro pro Monat betragen – ein Umstand, der bei herkömmlichen Geschenkkarten erst nach einem Jahr erlaubt ist und in manchen Bundesstaaten sogar ganz verboten ist. Diese Inaktivitätsgebühren führen dazu, dass ein großer Teil der ausgegebenen Gelder nie von den tatsächlichen Begünstigten ausgegeben wird. Experten sprechen von sogenannter „Breakage“ – also nicht eingelösten Guthaben auf den digitalen Karten.
Schätzungen zufolge beläuft sich dieser unbeabsichtigte (oder teilweise durchaus kalkulierte) Geldverlust über die letzten Jahre auf mehrere hundert Millionen Dollar. Problematisch ist hierbei, dass im Fall von digitalen Karten die ungenutzten Beträge nicht zurück in den Entschädigungsfonds fließen. Stattdessen kommen diese Gelder den Fintech-Unternehmen zugute, die die Karten ausstellen, den mitwirkenden Banken und den Verwaltungsfirmen, die für die Abwicklung der Sammelklagen verantwortlich sind. Zu den Hauptakteuren zählen dabei Kreditkartennetzwerke wie Blackhawk Network und das aufstrebende Startup Tremendous. Beide Unternehmen haben sich darauf spezialisiert, Millionen von Sammelklage-Betroffenen mit digitalem Guthaben zu versorgen.
Doch das Geschäftsmodell der Unternehmen edelt die Frage, ob es wirklich im Interesse der Verbraucher agiert. Schwarz auf Weiß dokumentierte E-Mails aus 2020, die im Zuge einer unabhängigen Untersuchung veröffentlicht wurden, zeigen, wie Blackhawk maßgebliche Abwickler für den Versand virtueller Prepaid-Karten mit erheblichen Rückvergütungen oder Rabatten lockte. Diese Zahlungen, als sogenannte Kickbacks bezeichnet, wurden in vielen Fällen nicht gegenüber Gerichten oder Anwälten offengelegt – was grundlegende Transparenz- und Compliance-Regeln verletzt. In der Praxis bedeuten solche verdeckten Zahlungen, dass ein erheblicher Anteil der Entschädigungssummen nicht den Geschädigten zufließt, sondern direkt in die Taschen von Private-Equity-besessenen Firmen und deren Partnern. Verwaltet werden die Sammelklagen von spezialisierten Dienstleistern, die alle wesentlichen Abläufe rund um Schadenersatzzahlungen übernehmen – sogenannte Settlement Administratoren.
Die drei größten unter ihnen, Angeion Group, Epiq Systems und JND Legal Administration, stehen inzwischen im Zentrum von Klagen, die ihnen vorwerfen, diese Kickbacks zu erhalten und damit Schadenersatzzahlungen zu schmälern. Diese Vorwürfe befeuern die Kritik an einem ohnehin stark kritisierten System, das schon zuvor wegen überzogener Anwaltsgebühren und geringer tatsächlicher Zahlungen an Betroffene in die Schlagzeilen geraten war. Zwar erhalten Kläger bei Sammelklagen oft mehr Aufmerksamkeit und bessere Aussichten als bei Einzelklagen, doch gehen regelmäßig große Teile der Summen an Anwälte, Verwaltungskosten und andere Zwischenparteien. Schadenersatzleistungen an die Betroffenen selbst liegen oft bei unter fünf Prozent aller zukünftigen Gelder – ein Verhältnis, das für viele unbefriedigend erscheint. Ein weiterer Aspekt der Herausforderungen ist der mangelnde gerichtliche Einblick in den Verbleib der Gelder nach der Auszahlung.
Von bundesweit 94 Bundesbezirksgerichten fordern nur wenige Gerichte sogenannte Post-Distribution Accounting-Berichte, die erklären, wie viel Geld tatsächlich bei den Geschädigten angekommen ist. Noch problematischer ist, dass die meistens Berichte, sofern sie überhaupt verlangt werden, meist ungenau sind und Breakage bei digitalen Karten nicht transparent erfassen. Dies öffnet Raum für Geheimniskrämerei und Veruntreuung von Geld, das eigentlich den Verbrauchern oder wohltätigen Organisationen zustehen sollte. Für Verbraucher wird es dadurch zur Herausforderung, die effektiv verfügbaren Entschädigungszahlungen zu verstehen und anzunehmen. Die technische Komplexität digitaler Auszahlungsmethoden überfordert viele Menschen, vor allem wenn die Summen gering sind.
Die digitale Prepaid-Karte lässt sich in der Regel nur an wenigen Stellen sinnvoll einsetzen oder mit zusätzlichen Gebühren wie etwa zum Aufladen von Amazon-Geschenkguthaben kombinieren – was nicht jeder von Beginn an weiß. Viele Betroffene wandern somit an den Angeboten vorbei oder vergessen die Karten, die dann nach Ablauf der Fristen an Wert verlieren. Trotz der massiven Kritik ist der Trend zur Digitalisierung der Auszahlungen nicht aufzuhalten. Die hohen Kosten für Versand von Papier-Schecks, Risiken von Betrug und nicht eingelösten Schecks sowie der Wunsch nach schnellerer Abwicklung treiben den digitalen Wandel im Sammelklagebereich voran. Jüngere Unternehmen wie Digital Disbursements wirtschaften mit Plattformen, die es Klägern ermöglichen, zwischen verschiedenen Auszahlungsmethoden zu wählen und die Verbraucher bei der Nutzung unterstützen.
Dabei setzt man sich für besser nutzbare Karten mit geringeren Inaktivitätsgebühren und längeren Fristen ein – um den Nutzen für die Endbegünstigten zu optimieren. Dennoch bleibt die Aufsicht über das komplexe System ein Kernproblem. Gesetze, die für traditionelle Geschenkkarten Gültigkeit haben, greifen bei digitalen Sammelklagekarten nicht. Das ermöglicht es Firmen, mit hohen monatlichen Gebühren Geld einzubehalten. Zudem stehen die privaten Finanzbeteiligungen vieler Akteure, darunter auch Banken, im Verdacht, an den fallenbleibenden Mitteln zu verdienen, ohne dass dies transparent gemacht wird.
Banken fungieren als Treuhänder der Gelder und sind an der Abwicklung beteiligt – aber wie die Zinseinnahmen aus den teilweise monatelang geparkten Summen verteilt werden, ist oft unklar und noch wenig reglementiert. Der Skandal um die Breakage-Mittel und die undurchsichtigen Rückvergütungen bei Sammelklagen brachte im Jahr 2025 eine neue Klage gegen die größten drei Settlement Administratoren ins Rollen, die von Private-Equity-Investoren kontrolliert werden. Die Kläger werfen den Beklagten vor, die Abgeltungen aus den Prepaid-Card-Breakages als verdeckte Kickbacks einzustreichen und diese wesentliche Information juristisch relevante Parteien – Anwälte, Richter und Betroffene – wissentlich zu verschweigen. Während die betroffenen Firmen sämtliche Vorwürfe zurückweisen, erwarten Experten, dass die Diskussion um Fairness, Transparenz und Verbraucherschutz rund um Sammelklagen und digitale Auszahlungen die nächsten Jahre prägen wird. Forderungen nach strengeren gesetzlichen Vorgaben, klareren Informationspflichten und freiwilliger Offenlegung der Einnahmen durch Verwaltungsgesellschaften gewinnen an Gewicht.
Neben den rechtlichen und operativen Lösungsvorschlägen schlagen viele Fachleute auch verbesserte Verbraucherinformationen vor. Dazu zählen verständliche Hinweise zur Nutzung der digitalen Karten, klarere Fristenregelungen für Gebühren, automatische Erinnerungen an Guthaben und die Möglichkeit des Geldtransfers auf übliche Bankkonten oder Zahlungssysteme wie PayPal und Venmo. Dies würde die Akzeptanz und den tatsächlichen Nutzen für die Betroffenen erhöhen. Obwohl die Situation komplex ist und zahlreiche Akteure involviert sind, zeigt sich eines deutlich: Ohne mehr Transparenz, Kontrolle und faire Bedingungen werden Sammelklagen als Mittel des Verbraucherschutzes an Wirkung verlieren und das Vertrauen der Betroffenen weiter erodieren. Gleichzeitig ist die Digitalisierung der Prozessschritte nicht aufzuhalten, bietet aber auch Chancen, effizientere und kostengünstigere Verfahren zu gestalten.