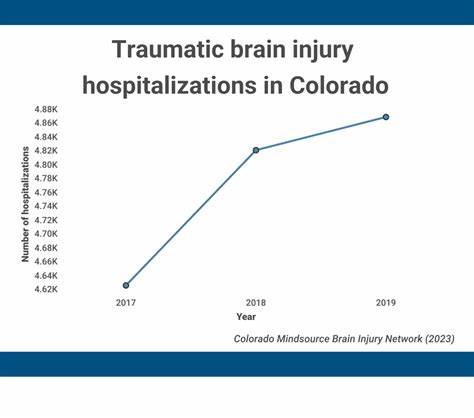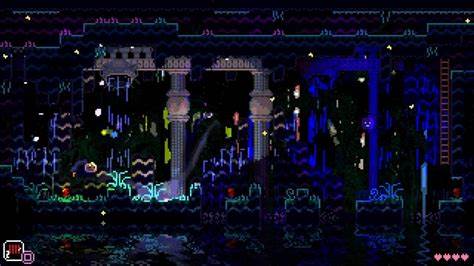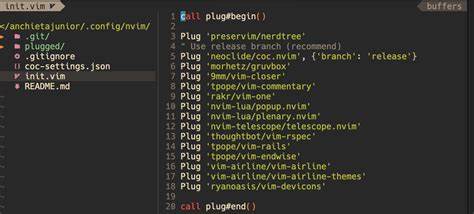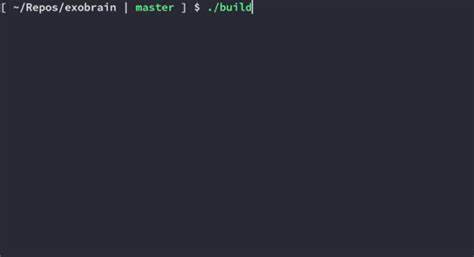Freundschaft gilt in der menschlichen Gesellschaft als ein entscheidender Faktor für Wohlbefinden, Gesundheit und Lebensqualität. Doch wie wirken sich soziale Verbindungen in der Tierwelt aus, speziell bei unseren nächsten Verwandten, den Berggorillas? Eine umfassende Langzeitstudie, die über zwei Jahrzehnte zahlreiche Daten von 164 wildlebenden Berggorillas aus dem Volcanoes-Nationalpark in Ruanda analysierte, liefert faszinierende Einblicke in die komplexe Natur von Freundschaften und sozialen Beziehungen bei diesen beeindruckenden Primaten. Sie zeigt auf, dass soziale Bindungen keine einseitig positiven Effekte haben, sondern sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringen, die teilweise stark vom Geschlecht, der Gruppengröße und anderen Kontextfaktoren abhängen. Diese Entdeckungen sind nicht nur für die Verhaltensforschung und Primatologie bedeutsam, sondern werfen auch ein neues Licht auf menschliche soziale Interaktionen und die Evolution von Freundschaft. Die Studie, die in der renommierten Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde, trägt den Titel „Group traits moderate the relationship between individual social traits and fitness in gorillas“.
Wissenschaftler von der Dian Fossey Gorilla Fund, der Universität Exeter und der Universität Zürich werteten hierfür umfangreiche Verhaltens- und Gesundheitsdaten aus, die im Laufe von mehr als 20 Jahren systematisch erhoben wurden. Dabei wurden soziale Bindungen anhand von Kriterien wie dem Grad der körperlichen Nähe, dem gemeinsamen Ruhen und der Häufigkeit von Unterstützungs- und Pflegeverhalten zwischen einzelnen Gorillaindividuen gemessen. Ein zentrales Ergebnis der Untersuchung ist, dass die Vorteile von Freundschaften nicht universell und auch nicht permanent gelten. Vielmehr hängt der Nutzen sozialer Beziehungen von mehreren Faktoren ab, die oft gegensätzliche Effekte erzeugen können. Besonders deutlich zeigte sich dies beim Vergleich der Geschlechter und Gruppengrößen.
Weibliche Gorillas, die enge soziale Bindungen in kleinen Gruppen pflegten, hatten seltener gesundheitliche Probleme, brachten aber gleichzeitig weniger Nachkommen zur Welt. In größeren Gruppen hingegen mussten diese Weibchen häufiger Krankheiten verkraften, erhielten jedoch auch eine höhere Fortpflanzungsrate. Die sozialen Beziehungen scheinen also in kleinen Verbänden vor Krankheit zu schützen, während in großen Gemeinschaften Reproduktion gefördert wird – vermutlich durch verstärkte Unterstützung und Schutz vor äußeren Gefahren. Männliche Gorillas hingegen verfolgten ein anderes Muster. Starke soziale Bindungen führten bei ihnen tendenziell zu mehr Erkrankungen, was zuerst widersprüchlich wirkt.
Allerdings wiesen diese sozial gut vernetzten Männchen gleichzeitig eine niedrigere Verletzungsrate in Kämpfen auf, was nahelegt, dass Freundschaften ihnen halfen, Konflikte zu vermeiden oder erfolgreich zu bewältigen. Möglicherweise ist der erhöhte Krankheitsanteil bei den Männchen eine Folge des erhöhten energetischen Aufwandes, der mit sozialen Verpflichtungen einhergeht, zum Beispiel dem Verteidigen von Weibchen und Nachwuchs sowie dem Umgang mit sozialem Stress, der das Immunsystem schwächen kann. Diese Geschlechterunterschiede verdeutlichen, wie vielfältig soziale Bindungen wirken und dass es kein Patentrezept für „ideale“ Freundschaft bei Gorillas gibt. Die Evolutionsbiologie kann durch solche Erkenntnisse erklären, warum eine Vielzahl an Persönlichkeitstypen und sozialen Strategien bei Menschen und anderen sozialen Tieren existiert. So kann es evolutionär sinnvoll sein, dass nicht alle Mitglieder einer Population gleich sozial aktiv oder eng verbunden sind, weil unterschiedliche Lebensumstände, Altersstufen oder Gruppendynamiken verschiedene Strategien begünstigen.
Die Forschung zeigt außerdem, dass die Gruppenkonstellation und deren Stabilität maßgebliche Rollen spielen. Gorillagruppen bestehen typischerweise aus etwa zwölf Mitgliedern, angeführt von einem dominanten Silberrücken-Männchen. Die Art und Weise, wie sich Freundschaften in einem solchen sozialen Gefüge entfalten, hat Einflüsse auf die Fitness der einzelnen Mitglieder sowie auf die Dynamik der gesamten Gruppe. So können stabile soziale Bindungen zu größerer Toleranz und weniger Konflikten führen, während instabile Umgebungen mit Gruppenwechseln oder Rivalitäten Stress und Herausforderungen mit sich bringen. Fallbeispiele aus der Studie illustrieren diese komplexen Zusammenhänge eindrucksvoll.
Die erwachsene Gorilla-Dame Gutangara lebt in einer der größten Gruppen und pflegt zahlreiche Beziehungen, verbringt aber den Großteil ihrer Zeit mit ihren Nachkommen. Sie gilt als besonders erfolgreiche Mutter mit acht überlebenden Jungen. Im Gegensatz dazu stand Maggie, die höchste rangierte weibliche Gorilla im Bwenge-Großverbund, die sich durch gelegentliche Aggressionen auszeichnete, aber auch schnell Freundschaften knüpfte und ihre Gruppenkameraden durch Pflegeverhalten unterstützte. Nachdem der dominante Silberrücken unerwartet starb, übernahm Maggie sogar eine Führungsrolle. Doch die Aufnahme in eine neue Gruppe gestaltete sich für sie schwierig, sodass sie sich isolierte und schließlich verschwand.
Solche Beispiele zeigen, wie unterschiedlich soziale Entscheidungen und Freundschaftsstrategien ausfallen können und welche Konsequenzen sie für das Individuum haben. Auch bei den männlichen Silberrücken offenbart die Studie vielfältige Persönlichkeitstypen. Titus, ein dominanter Silberrücken aus schwierigen Kindheitserfahrungen, war für seine sanfte und ruhige Führung bekannt. Seine engen sozialen Bindungen zu Weibchen und der daraus resultierende physische Kontakt sind ungewöhnlich und vermutlich ein Schlüsselfaktor für seine lange 20-jährige Herrschaftszeit. Ein weiteres Beispiel ist Cantsbee, der mit 22 Jahren die längste Dominanzzeit in der Forschungsgeschichte aufweist und mindestens 28 Nachkommen zeugte.
Sein ruhiges, aber durchsetzungsfähiges Wesen trug wesentlich zur Gruppenstabilität bei. Trotzdem zog er sich im Krankheitsfall zurück und verbrachte seine letzten Monate weitgehend isoliert, was auf eine Selbstregulation sozialer Beziehungen im Alter oder bei schlechter Gesundheit hindeutet. Diese Verhaltensmuster lassen sich nur durch langfristige und detaillierte Beobachtungen verstehen. Die Bedeutung von Langzeitstudien wird hierbei erneut unterstrichen, da kurzfristige Untersuchungen oft keine klaren Ergebnisse zu komplexen sozialen Dynamiken liefern können. Durch die Kombination von Verhaltensbeobachtung, Gesundheitsdaten und Fortpflanzungserfolgen über Jahrzehnte hinweg erhalten Wissenschaftler ein differenziertes Bild sozialer Interaktionen und deren evolutionären Auswirkungen.
Die Implikationen dieser Forschung reichen über die Primatologie hinaus und können auch menschliche Sozialsysteme beleuchten. Wie bei Gorillas sind soziale Beziehungen beim Menschen ein zweischneidiges Schwert. Zwar kann ein unterstützendes Netzwerk das Risiko für Krankheiten vermindern und allgemein das Wohlbefinden steigern, doch können intensive soziale Verpflichtungen auch Stress auslösen und das Immunsystem beeinträchtigen, insbesondere wenn sie mit Konflikten, Konkurrenz oder emotionaler Belastung verbunden sind. Zudem hängt der Effekt sozialer Bindungen stark vom individuellen Lebenskontext ab – vom sozialen Umfeld, der Lebensphase, den persönlichen Bedürfnissen und Strategien. Die Studie liefert somit wichtige Erkenntnisse darüber, wie sich „Freundschaft“ biologisch und evolutiv verstanden lässt.
Freundschaft ist kein universelles Gut, sondern ein facettenreiches Phänomen mit situativen Vor- und Nachteilen, das innerhalb einer Population unterschiedliche Rollen erfüllen kann. In der Evolution sozialer Tiere hat sich ein Gleichgewicht herausgebildet, das eine Vielfalt an sozialen Typen fördert, um in variierenden Umwelten zu überleben und sich fortzupflanzen. Mit Blick auf den Schutz und die Erhaltung der Berggorillas bietet das Verständnis ihrer sozialen Dynamiken wichtige Anhaltspunkte. Schutzprogramme können durch die Kenntnis sozialer Strukturen besser gestaltet und angepasst werden, um Stress für die Tiere zu minimieren und stabile Gruppenbildungen zu fördern. Dies trägt langfristig nicht nur zum Wohlergehen der Tiere bei, sondern unterstützt auch die Erhaltung dieser bedrohten Art.
Zusammenfassend zeigen die Erkenntnisse aus der zweijahrzehntelangen Erforschung der Berggorillas, dass soziale Bindungen ein vielschichtiges und dynamisches Phänomen sind. Die Natur der Freundschaft ist geprägt von einem komplexen Zusammenspiel aus Geschlecht, Gruppengröße, individuellen Bedürfnissen und äußerem Umfeld. Diese Komplexität offenbart nicht nur, warum soziale Vielfalt innerhalb von Populationen existiert, sondern liefert auch wertvolle Einsichten für das Verständnis menschlicher Sozialisierung und Gesundheit. Die Evolution hat soziale Beziehungen als flexibles Instrument gestaltet, das je nach Kontext unterschiedlich eingesetzt wird – mit allen Vorzügen, aber eben auch mit Herausforderungen, die sorgfältig austariert werden müssen.