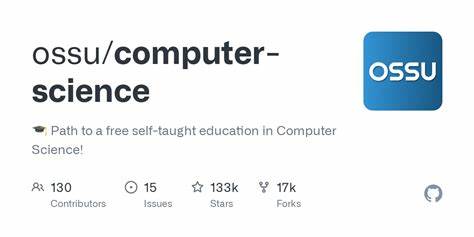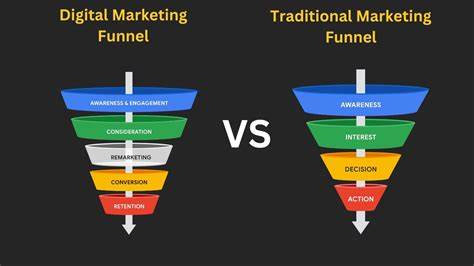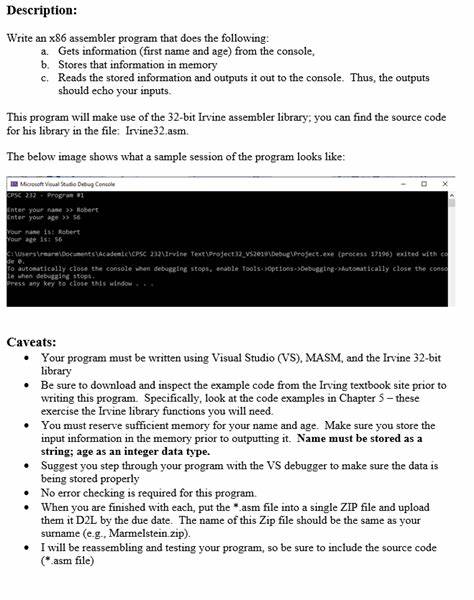Am 16. Mai 2025 kündigte die Ratingagentur Moody’s eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika an. Das höchste Rating Aaa (AAA) wurde auf das zweithöchste Niveau AA+ (Aa1) gesenkt. Diese Entscheidung hat in Finanzkreisen und bei Investoren große Aufmerksamkeit erregt. Doch was bedeutet diese Herabstufung genau und welche wirtschaftlichen Perspektiven lassen sich daraus ableiten? Um diese Fragen zu beantworten, ist es zunächst wichtig, die Rolle von Kreditratings und ihre Funktionsweise zu verstehen.
Kreditratings dienen als Indikatoren, die das Risiko des Zahlungsausfalls eines Schuldners bewerten. Für Staaten spricht man von Staatsanleihen; ihr Rating zeigt Investoren das wahrgenommene Risiko dieser Anlagen. Eine hohe Bonitätsbewertung signalisiert, dass die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls sehr gering ist, was wiederum niedrigere Zinssätze für den Schuldner bedeutet. Kreditratingagenturen wie Moody’s, Fitch und Standard & Poor’s gelten dabei als maßgeblich und beeinflussen das Vertrauen auf den globalen Kapitalmärkten erheblich. Die Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit durch Moody’s ist nicht ohne Vorgeschichte.
Bereits im August 2023 hatten Fitch und Standard & Poor’s die Kreditnote der USA von AAA auf AA+ gesenkt. Diese Agenturen verweisen dabei vor allem auf politische Unsicherheiten, wie die langwierigen Verhandlungen um die Anhebung der Schuldengrenze, sowie auf stetig steigende Verschuldungs- und Zinsbelastungen. Moody’s folgte letztlich mit ähnlichen Bedenken und betonte die wachsenden Staatsausgaben für obligatorische Leistungen wie Renten und Gesundheitsversorgung, die das Defizit erhöhen und den Schuldendienst erschweren. Doch das Verständnis für die tatsächlichen Risiken, die eine solche Ratingänderung mit sich bringt, verlangt einen Blick über die bloße subjektive Einstufung hinaus. Kreditratings basieren zwar auf fundierten statistischen Modellen, sind jedoch auch Interpretationen mit einem gewissen Grad an Subjektivität.
Die Geschichte lehrt, dass Ratings nicht unfehlbar sind. So spielten Kreditratingagenturen eine zentrale Rolle in der Finanzkrise 2007–2008, als hoch bewertete Collateralized Debt Obligations (CDOs) massenhaft ausfielen, obwohl sie als außerordentlich sicher galten. Angesichts der Bedeutung von Ratingentscheidungen für Staaten ist ein tieferes Verständnis der zugrunde liegenden wirtschaftlichen Indikatoren entscheidend. Eine wichtige Kennzahl ist das Verhältnis der Staatsschulden zum Bruttoinlandsprodukt (BIP). Es steht im Zentrum vieler Debatten über die Nachhaltigkeit von Staatsschulden.
Ein hohes Schulden-BIP-Verhältnis wird dabei häufig als Warnsignal gewertet, doch die bloße Höhe dieser Kennzahl lässt viel Interpretationsspielraum, wenn sie isoliert betrachtet wird. Wesentlich aussagekräftiger ist das Verhältnis von Zinssatz auf die Schulden zu Wirtschaftswachstumsraten. Ist der Zinssatz niedriger als das nominale Wirtschaftswachstum, kann sich ein Staat in gewissem Maße fast „kostenlos“ verschulden, da das Bruttowirtschaftsvolumen schneller wächst als die Zinskosten. Dieses Phänomen wurde von Ökonomen wie Oliver Blanchard ausführlich diskutiert und erneut Aufmerksamkeit geschenkt. Die USA befinden sich derzeit in einer solchen Situation, in der der langfristige Zinssatz für Staatsanleihen unterhalb des nominalen BIP-Wachstums liegt, was eine nachhaltige Schuldenpolitik ermöglicht und sogar produktive Investitionen fördert.
Dennoch bestehen Risiken, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Wenn der Zinssatz für die Verschuldung nachhaltig über dem Wirtschaftswachstum liegt, können sich Schulden exponentiell erhöhen, da die Zinszahlungen die wirtschaftlichen Einnahmen übersteigen. In einem solchen Fall muss der Staat entweder durch Steuererhöhungen die Schulden reduzieren oder den Zahlungsausfall in Kauf nehmen. Die politische Realität zeigt, dass Steuererhöhungen oft unbeliebt sind, was die Gefahr von Zahlungsunfähigkeit theoretisch erhöht. Vor diesem Hintergrund bleibt die Frage nach dem optimalen oder sicheren Niveau der Staatsschulden offen.
Während die Europäische Union finanziell enge Vorgaben macht, ist der ökonomische Konsens darüber begrenzt, da die fiscal rules nicht für alle Staaten gleichermaßen passen. Einige Studien legen nahe, dass die USA ein relativ hohes Schuldenlimit, etwa zwischen 150 und 220 Prozent der Wirtschaftsleistung, tragen könnten, ohne finanziell instabil zu werden. Die aktuelle Verschuldung liegt bei etwa 120 Prozent des BIP, was nach diesen Einschätzungen innerhalb der tolerierbaren Grenze liegt. Trotz der Einschätzung, dass die USA wirtschaftlich in der Lage sind, ihre Schulden zu bedienen, bleibt die Signalfunktion der Kreditratings nicht unwichtig. Die Herabstufungen können das Vertrauen der Investoren beeinflussen, was zu höheren Risikoprämien und damit zu höheren Zinskosten für die Staatsanleihen führen kann.
Zudem gibt es institutionelle Investoren, wie Pensions- und Versicherungsfonds, deren Anlagekriterien Ratings in bestimmten Bändern vorsehen, was deren Investitionsverhalten ändert. Eine weitere Frage, die das Kreditrating betrifft, ist, welches Vertrauen die Investoren in die politische Stabilität und die fiskalische Führung eines Landes setzen. Moody’s und andere verweist explizit auf politische Risiken, die durch ungelöste Haushaltskonflikte entstehen. Hier steht neben der reinen Finanzkennzahl auch das politische Handeln und die Verlässlichkeit von Konsens im Fokus. Es ist jedoch hervorzuheben, dass US-Staatsanleihen nach wie vor als eine der sichersten Anlagen angesehen werden.
Trotz der Herabstufung durch Moody’s liegt die US-Kreditwürdigkeit in der absoluten Spitzengruppe. Weltweit gibt es nur wenige Staatsanleihen mit einer AAA-Bewertung und selbst diese Herabstufung ändert nichts an der Tatsache, dass US-Treasuries weiterhin als globale Referenz gelten. Aus ökonomischer Perspektive zeigt die aktuelle Lage, dass die Nutzung von Staatsschulden als Finanzierungsinstrument auch positive Effekte haben kann. Indem der Staat Investitionen in produktive Bereiche tätigt, die das Wachstum fördern, können Schulden sinnvoll eingesetzt werden, um langfristigen Wohlstand zu sichern. Die Vergabe von Schulden zu Zinsen, die unter den Wachstumsraten liegen, unterstützt diese Strategie.
Im Gegensatz dazu führt eine zu restriktive Fiskalpolitik, die auf kurzfristige Konsolidierung setzt, auch zu negativen Konsequenzen. Ein Beispiel dafür wäre eine anhaltende Reduktion der Staatsausgaben, die in einer wirtschaftlichen Schwächephase das Wachstum hemmt und Beschäftigung gefährdet. Langfristig kann dies auch die Fähigkeit zur Schuldentilgung schwächen. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit durch Moody’s einerseits als ein Warnsignal verstanden werden sollte, das politische und finanzielle Herausforderungen anzeigt. Andererseits liefern wirtschaftswissenschaftliche Analysen Hinweise darauf, dass die USA finanziell gut positioniert sind, um ihre Verpflichtungen zu erfüllen.
Die Effekte einer solchen Ratingveränderung sind vielschichtig und gehen über das rein Finanzielle hinaus, indem sie Vertrauen, politische Stabilität und wirtschaftspolitische Entscheidungen beeinflussen. Für Investoren, Politiker und Bürger bleibt es wichtig, diese Signale genau zu analysieren, um angemessen auf Herausforderungen reagieren zu können. Die US-Schuldenfrage ist ein komplexes Zusammenspiel von Wirtschaftsleistung, Zinsentwicklung und Politik, das nur durch eine differenzierte Betrachtung zu verstehen ist. Die Debatte um die Kreditwürdigkeit wird weitergehen – und bietet Raum für fundierte Diskussionen über fiskalische Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit.



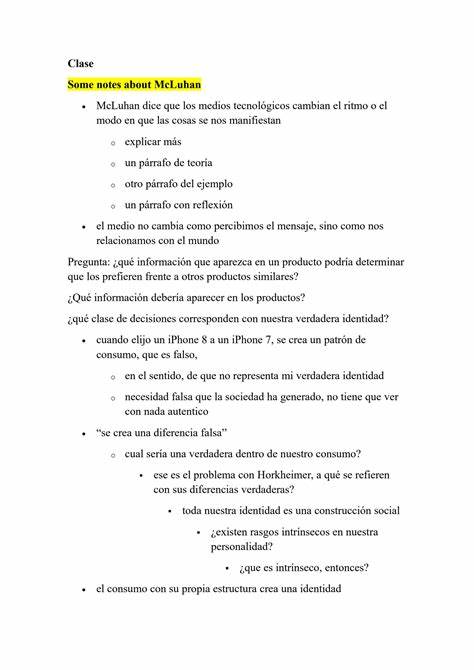
![Windows was the problem all along [video]](/images/2C241A6D-57CA-4759-B723-751BA4BF985F)