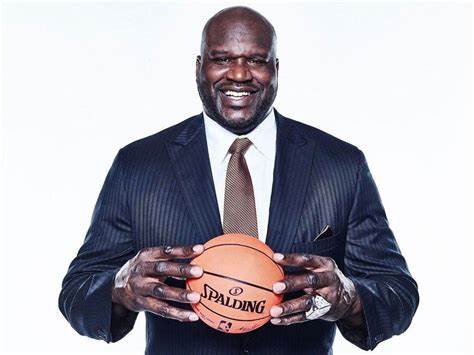Im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz erleben wir einen rasant wachsenden Bedarf an leistungsfähiger und vielseitiger Computerinfrastruktur, die den Anforderungen moderner KI-Anwendungen gerecht wird. Eine zentrale Herausforderung dabei ist die Fragmentierung in der Softwarelandschaft, insbesondere bei der Kompilierung von KI-Modellen und Optimierung für verschiedenste Hardwareplattformen. Hier spielt die MLIR Compiler-Infrastruktur eine bedeutende Rolle, die seit ihrer Entstehung einen grundsätzlichen Wandel in der Art und Weise bewirkt hat, wie KI-Software übersetzt und ausgeführt wird. Bis 2018 war die KI-Softwareentwicklung geprägt von einem zunehmenden Systemfragmentierungsproblem. Frameworks wie TensorFlow, PyTorch, JAX, Glow, ONNX, TensorFlow-Lite, XLA und TVM erlebten eine Explosion an individuellen Graphsystemen und Operatoren, die sich zum Teil überschneiden, zum Teil aber auch inkompatibel waren.
Jeder Anbieter konzipierte eigene KI-Grafiken mit spezifischen Operationen, um Optimierungen für unterschiedliche Hardware zu ermöglichen. Das Resultat war jedoch ein ineffizientes, zersplittertes Ökosystem, das sowohl die Entwicklung verlangsamte als auch neue Innovationen erschwerte. Inmitten dieser Problematik entstand MLIR, eine Abkürzung, die ursprünglich für Multi-Level Intermediate Representation steht. Die Befürworter und Entwickler sahen darin die Möglichkeit, eine modulare und erweiterbare Compiler-Infrastruktur zu schaffen, die auf verschiedene Hardwareplattformen und ML-Frameworks gleichermaßen anwendbar ist. Der Kerngedanke war, eine gemeinsame Basis zu schaffen, die nicht nur als Fundament für ein einheitliches Verständnis von KI-Berechnungen dient, sondern auch als Plattform für verschiedene Optimierungen und Anpassungen an spezifische Anforderungen.
Chris Lattner, eine Schlüsselfigur in der Entwicklung von LLVM, war maßgeblich daran beteiligt, MLIR zu initiieren. Unterstützt durch Jeff Dean, einem legendären Ingenieur bei Google, entstand 2018 die Idee, den fragmentierten Ansatz durch eine gemeinsame Repräsentation von Rechenoperationen zu ersetzen. Die damalige Herausforderung bestand darin, eine Lösung zu finden, mit der man sämtliche AI-Frameworks, Hardware-Backends und Optimierungsmethoden in einem flexiblen und modularen System vereinen konnte. Das Ergebnis war die Einführung sogenannter MLIR-Dialekte. Diese Dialekte ermöglichen es Entwicklerteams, individuell zugeschnittene Intermediate-Repräsentationen zu schaffen, ohne dabei das gesamte System umbauen zu müssen.
Das stellt einen bedeutenden Vorteil gegenüber klassischen Compiler-Infrastrukturen wie LLVM dar, die oftmals monolithisch und starr sind. Ein weiteres wesentliches Merkmal von MLIR ist die Unterstützung von mehreren Abstraktionsebenen innerhalb einer einheitlichen Umgebung. Dadurch können beispielsweise niedrigere Repräsentationen, die hardware-nah sind, nahtlos mit höher abstrahierten Darstellungen für komplexe mathematische Operationen zusammenwirken. Dieser modulare Aufbau erlaubt eine hohe Flexibilität und fördert eine bessere Wiederverwendbarkeit von Komponenten über verschiedenste Projekte hinweg. Nach dem anfänglichen Design im kleinen Kreis begann MLIR schnell, innerhalb von Google an Bedeutung zu gewinnen.
Teams, die an maßgeschneiderten ASICs arbeiteten oder sich auf mobile KI-Anwendungen spezialisierten, erkannten den Nutzen von MLIR, die optimale Maschinenbefehle für ihre Hardware effizient zu generieren. Zudem wurde MLIR schrittweise in TensorFlow Lite integriert, was eine breite Akzeptanz im Entwicklerumfeld weiter vorantrieb. Parallel dazu nutzten einzelne Forscher und externe Entwickler die Offenheit und Modularität von MLIR, um eigene Compiler-Ansätze zu entwickeln und so die Technik weiter zu erforschen und zu verbessern. Der Schritt zur Open-Source-Entwicklung war ein Meilenstein für MLIR. Die Integration in die LLVM Foundation erlaubte es einer Vielzahl von Unternehmen und Entwicklern, aktiv zum Projekt beizutragen.
Diese Öffnung führte zu einer Vielzahl von neuen Anwendungen, von Quantum Computing über Hardwaredesign bis hin zum Ausbau von KI-Compilern für unterschiedliche Plattformen. Große Firmen und Start-ups weltweit sahen MLIR als Grundlage für ihre nächste Compiler-Generation und trieben Innovationen mit der modularen Struktur voran. Dennoch ist MLIR trotz der technischen Fortschritte mit einer großen Herausforderung konfrontiert: der Fragmentierung des Ökosystems. Die ursprüngliche Vision der Demokratisierung von KI-Compute durch eine einheitliche Compiler-Infrastruktur ist bisher nur teilweise Realität geworden. Einer der Hauptgründe liegt in den Machtkämpfen und Interessenkonflikten innerhalb der Branche.
Während MLIR technisch zu einer entscheidenden Infrastruktur herangewachsen ist, konkurrieren Unternehmen um die Vorherrschaft bei der Umsetzung von End-to-End-Lösungen. Projekte wie OpenXLA oder Triton verwenden zwar MLIR als Fundament, doch ein durchgängiges, branchenweit akzeptiertes AI-Stack basierend auf MLIR blieb bislang aus. Diese Situation wird noch dadurch erschwert, dass viele Entwickler von Anfang an auf unterschiedliche Dialekte und spezielle Erweiterungen gesetzt haben, die nicht immer perfekt aufeinander abgestimmt sind. Die Spannung zwischen offenen Kollaborationen und kommerziellen Interessen führte zu einem Szenario, in dem sich einstige Weggefährten zu Konkurrenten entwickelten. Dieser Wettbewerb hat einerseits die Innovation befördert, andererseits aber auch den Wunsch nach einer einheitlichen, interoperablen Lösung erschwert.
Zudem fehlt aktuell ein klarer, gemeinschaftlicher Führungsanspruch für die KI-spezifischen Dialekte in MLIR. Während das Core-Framework stabil und allgemein anerkannt ist, gelten die AI-Dialekte als fragmentiert und teilweise nicht für die neuesten Anforderungen, wie die der Generativen KI und großen Sprachmodellen, optimiert. Trotz der beeindruckenden Entwicklungsgeschwindigkeit und des breiten Engagements ist MLIR in Bezug auf Performance im Vergleich zu NVIDIA CUDA auf führenden GPUs noch im Hintertreffen. Die Erfolgsgeschichte von NVIDIA mit CUDA zeigt eindrucksvoll, wie wichtig vertikale Integration und enge Verzahnung von Hard- und Software sowie Anwendungssupport sind. CUDA ist viel mehr als nur eine technische Infrastruktur – es ist eine umfassende Plattform, die durch konsequente Optimierungen, engagierte Software-Teams vor Ort und eine langfristige strategische Ausrichtung besticht.
Andere Hardwarehersteller und deren Softwareprojekte haben es bisher nicht geschafft, diesem Beispiel in gleichem Maße nachzueifern, obwohl sie oft über beträchtliche Ressourcen und hochqualifizierte Teams verfügen. Ein Hoffnungsschimmer für MLIR besteht in der neuen Governance-Struktur innerhalb der LLVM-Community. Mit klar definierten Zuständigkeiten für den Kern und die Dialekte sowie einem demokratischen Area-Team wird versucht, die Fragmentierung zu bekämpfen und die Weiterentwicklung gezielter zu steuern. Eine künftige klare Trennung und Namensgebung, zum Beispiel durch Umbennung der AI-Dialekte in „TensorIR“, könnte helfen, Missverständnisse zu vermeiden und die Identität der Plattform zu stärken. Das MLIR-Projekt zeigt exemplarisch, wie ambitionierte Infrastrukturprojekte mit großem Potenzial durch zu frühes Skalieren und mangelnde kohärente Führung ausgebremst werden können.
Häufig sind kleinere, fokussierte Teams in der Lage, eine klare Vision zu verfolgen und erfolgreich umzusetzen. Erst wenn die Grundfunktionalitäten stabil etabliert sind, macht es Sinn, die Community auf breiter Basis einzubinden. Diese Erkenntnis lässt sich auch aus den Erfahrungen von LLVM, Clang oder Swift ableiten. Mit seinen vielen Dialekten bietet MLIR eine beeindruckende Plattform für Compilerbauer und systemnahe Entwickler. Dennoch muss der Spagat gelingen, die Komplexität zu bändigen, die Akzeptanz bei KI-Entwicklern zu erhöhen und die Performance auf den führenden Hardwareplattformen zu maximieren.