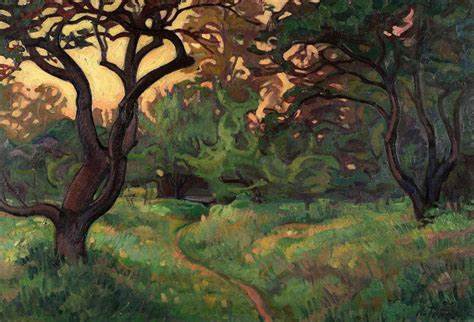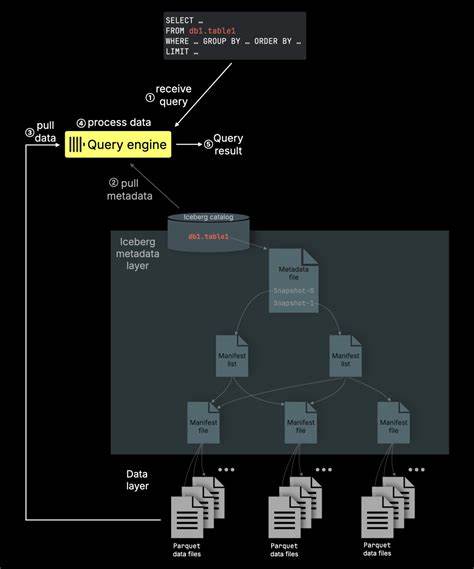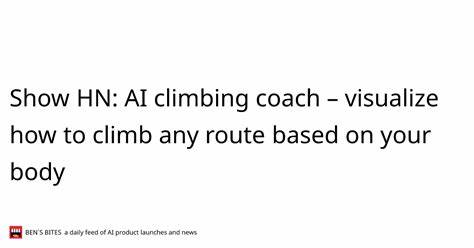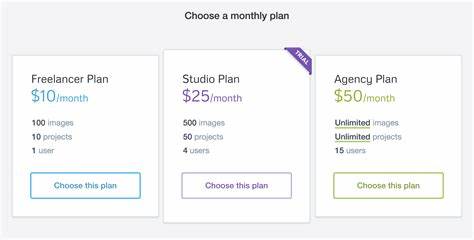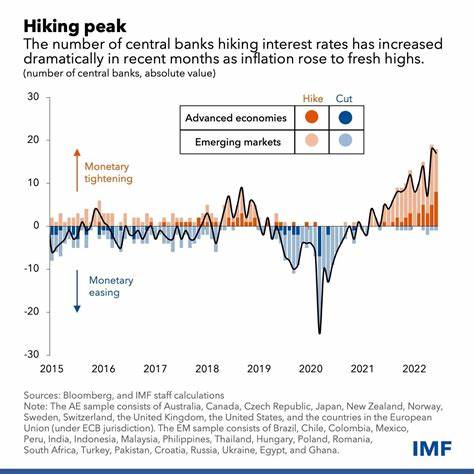Die Rolle der Pflanzen im Erdklimasystem ist seit langem anerkannt, doch aktuelle Forschungsergebnisse haben nun eine verblüffende Erkenntnis ans Licht gebracht: Pflanzen absorbieren weltweit 31 % mehr Kohlendioxid (CO2) als bisher geschätzt. Diese bedeutsame Entdeckung hat das Potenzial, klimawissenschaftliche Modelle und die Einschätzung zukünftiger Klimaentwicklungen maßgeblich zu verändern. Die neuen Daten stammen von einem interdisziplinären Forscherteam unter der Leitung der Cornell University und dem Oak Ridge National Laboratory. Ihre Arbeit basiert auf innovativen Messmethoden und einer tiefergehenden Analyse der pflanzlichen Photosyntheseprozesse. Das Ergebnis verschiebt das Verständnis der globalen Kohlenstoffaufnahme durch Wälder, Grasländer und andere Ökosysteme erheblich.
Traditionell wurde die Menge des von Pflanzen aufgenommenen CO2 über Satellitendaten und indirekte Modellierungen geschätzt. Für Jahrzehnte lag der Wert der sogenannten Bruttoprimärproduktion (Gross Primary Production, GPP) bei etwa 120 Petagramm Kohlenstoff pro Jahr. Diese Zahl galt als Standard, um den Land-Kohlenstoffkreislauf zu beschreiben. Doch die neuen Erkenntnisse zeigen, dass der wahre Wert der GPP eher bei 157 Petagramm pro Jahr liegt, was einen Anstieg von 31 % bedeutet. Diese deutlich höhere Aufnahmefähigkeit der Flora hat weitreichende Konsequenzen für das Verständnis der globalen Kohlenstoffdynamik und letztlich auch für das Klima.
Das Team entwickelte neue Modelle, die auf der Messung von Kohlenoxidsulfid (OCS) basieren, einem seltenen Gas, das eng mit der Photosynthese verbunden ist. Pflanzen nehmen OCS auf, ähnlich wie sie CO2 absorbieren, geben OCS jedoch nicht wieder ab. Diese Eigenschaft macht OCS zu einem idealen Tracer, um die Photosynthesetätigkeit direkt und präzise zu messen. Die Anwendung von OCS bei der Analyse ist ein bedeutender Fortschritt gegenüber bisherigen Techniken, die oft durch Wolkenbedeckung oder andere atmosphärische Störeinflüsse bei Satellitenmessungen behindert wurden, insbesondere in tropischen Regionen. Ein weiterer wesentlicher Faktor in der neuen Forschung ist die Berücksichtigung der sogenannten Mesophyll-Diffusion.
Dieser Prozess beschreibt die Bewegung von CO2 und OCS von der Blatthaut durch die Mesophyllschichten in die Chloroplasten, wo die Photosynthese tatsächlich stattfindet. Frühere Modelle haben diesen Mechanismus oft vereinfacht oder vernachlässigt, was zu einer Unterschätzung der Pflanzeneffizienz bei der CO2-Aufnahme führte. Die Integration detaillierter Mesophyll-Diffusionsprozesse in bestehende Klimamodelle, wie das Community Land Model Version 5 (CLM5), ermöglichte eine wesentlich präzisere Simulation des Kohlenstoffaustauschs zwischen Pflanzen und Atmosphäre. Neue Messungen zeigten zudem, dass Pflanzen auch nachts CO2 aufnehmen, was zuvor als vernachlässigbar galt. Die nächtliche OCS-Aufnahme macht etwa 20 bis 30 Prozent der täglichen Gesamtaufnahme aus, was die Komplexität der Photosynthese und anderer physiologischer Prozesse unterstreicht.
Die Erkenntnis verweist auf eine bislang unterschätzte pflanzliche Aktivität in den sogenannten Dormanz- und Übetragszeiten – Perioden, die bisher als relativ inaktiv galten. Besonders beeindruckend ist die höhere Kohlenstoffaufnahme in tropischen Regenwäldern. Diese Ökosysteme wurden durch herkömmliche, satellitenbasierte Methoden häufig unterschätzt, was unter anderem an der dichten Wolkendecke und atmosphärischen Störungen liegt. Die neue Methodik unterstreicht, wie bedeutend tropische Wälder als Kohlenstoffsenken sind – nicht nur für den regionalen, sondern auch für den globalen Kohlenstoffkreislauf. Da diese Wälder eine zentrale Rolle im Klimageschehen einnehmen, könnten die verbesserten Daten wichtige Impulse für internationale Klimaschutzstrategien geben.
Das verbesserte Verständnis der Pflanzendynamik führte zu einer Verfeinerung der globalen Klimamodelle, die Zukunftsszenarien des Klimawandels prognostizieren. Indem natürliche Kohlenstoffsenken genauer quantifiziert werden, lässt sich besser einschätzen, wie schnell die CO2-Konzentration in der Atmosphäre steigen wird. Dies wiederum beeinflusst die Vorhersagen des Meeresspiegelanstiegs, der Temperaturentwicklung und der Häufigkeit extremer Wetterereignisse weltweit. Die Bedeutung solcher Erkenntnisse geht jedoch über die reine Klimaforschung hinaus. Ein tiefergehendes Verständnis der Photosynthese und der Kohlenstoffaufnahme ist auch für die Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Biodiversitätsförderung entscheidend.
Pflanzen reagieren auf Umweltveränderungen, wie Temperatur- und Niederschlagsvariabilationen, unterschiedlich in ihrer CO2-Aufnahme. Verbesserte Modelle können vorhersagen, wie sensible Ökosysteme auf Klimastress reagieren und welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind, um ihre Rolle als Kohlenstoffsenken zu erhalten oder zu stärken. Darüber hinaus eröffnen die neuen Daten wertvolle Perspektiven für technologische Innovationen im Bereich der Kohlenstoffbindung und nachhaltigen Landnutzung. Die Kopplung biologischer Prozesse mit technischer CO2-Sequestrierung könnte in Zukunft verstärkt genutzt werden, um Emissionen zu kompensieren und die Erderwärmung zu begrenzen. Wissenschaftler betonen, dass das Vorantreiben der Forschung zur Mesophyll-Diffusion und der OCS-basierten Messungen wichtig ist, um Unsicherheiten in den GPP-Schätzungen weiter zu reduzieren.
Multidisziplinäre Kooperationen zwischen Biologie, Atmosphärenwissenschaften und Computerwissenschaften sind hierbei unerlässlich. Die Datenbank LeafWeb hat sich dabei als wertvolle Ressource erwiesen, da sie eine breite Palette an pflanzlichen Fotosynthese-Eigenschaften weltweit sammelt und zugänglich macht. Die Ergebnisse spiegeln auch die zunehmende Bedeutung bodengestützter Beobachtungen wider. Während Satellitenmessungen wichtige großräumige Daten liefern, sind sie in vielen Fällen nicht ausreichend genau, um lokale und saisonale Variationen vollständig abzubilden. Umweltüberwachungstürme und Feldmessungen ergänzen das Bild und helfen, feinkörnige Prozesse in Ökosystemen besser zu verstehen.
Das Forschungsteam sieht in dieser Erkenntnis eine Gelegenheit, die Modellierung der globalen Kohlenstoffkreisläufe zu revolutionieren. Durch die Integration verbesserter physiologischer Parameter und neuer Messverfahren wird eine präzisere und realistischere Darstellung der pflanzlichen CO2-Aufnahme möglich – ein entscheidender Schritt im Kampf gegen den Klimawandel. Ganzheitlich betrachtet, unterstreichen diese Entwicklungen einmal mehr die essenzielle Rolle natürlicher Ökosysteme für das Gleichgewicht unseres Planeten. Neben technologischen Lösungen bleibt der Schutz und die nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern und anderen Pflanzengemeinschaften eine Schlüsselkomponente der Klimapolitik. Die neu gewonnenen Erkenntnisse bestärken diese wichtige Ausrichtung und geben Hoffnung, dass menschliche Maßnahmen durch Naturprozesse wirksam unterstützt werden können.