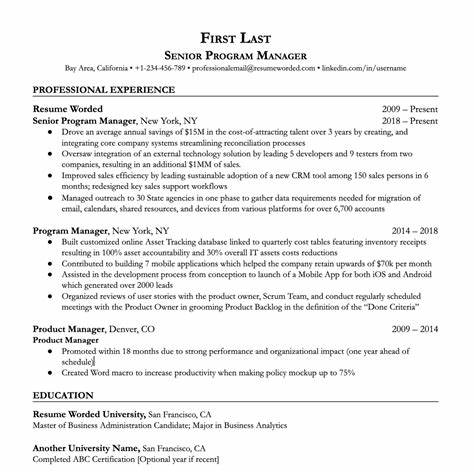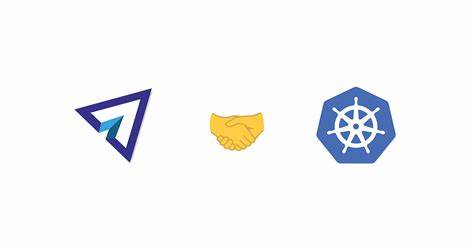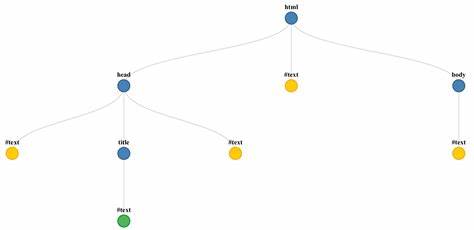Der Markt für ARM-basierte Computer hat in den vergangenen Jahren stark an Dynamik gewonnen. Während ARM-Prozessoren traditionell in Mobilgeräten zum Einsatz kommen, wächst das Interesse an leistungsfähigen ARM-Systemen für Desktop-PCs kontinuierlich. In diesem Kontext sticht der Radxa Orion O6 als eines der interessantesten Midrange-Angebote hervor, das nicht nur mit beeindruckender Hardware, sondern auch mit der Möglichkeit punktet, gängige Desktop-Betriebssysteme wie Windows 11 und verschiedene Linux-Distributionen nativ zu betreiben. Doch trotz seiner vielversprechenden Spezifikationen und seines vergleichsweise günstigen Preises werden Käufer mit einigen Hürden konfrontiert, die sowohl technisches Verständnis als auch Geduld erfordern. Das Herzstück des Orion O6 ist ein CIX CD8180 System-on-a-Chip (SoC), das auf der neuesten ARMv9.
2 Architektur basiert. Mit insgesamt 12 CPU-Kernen, die in drei verschiedene Leistungsklassen unterteilt sind – vier „big“ Cortex-A720-Kerne mit bis zu 2,6 GHz, vier „medium“ A720-Kerne mit 2,4 GHz und vier „little“ Cortex-A520-Kerne mit 1,8 GHz – bietet der Prozessor eine gute Mischung aus Leistung und Effizienz. Dazu kommen 12 MB gemeinsamer L3-Cache sowie eine integrierte Arm Immortals G720 MC10 GPU, die für grundlegende Grafik- und Multimediaanwendungen gut geeignet ist. Ein besonderes Highlight ist die integrierte Cix NPU mit einer Leistung von 30 TOPS, die speziell für Aufgaben im Bereich künstliche Intelligenz ausgelegt ist und den Einsatz von neuronalen Netzwerken und Maschinenlernen auf Hardware-Ebene ermöglicht. Ein weiteres starkes Merkmal des Orion O6 ist die Unterstützung von bis zu 64 GB LPDDR5 RAM mit einem 128-Bit-Bus.
Die hohe Speicherbandbreite von theoretisch bis zu 96 GB/s (gemessen wurden zwischen 40 und 50 GB/s im realen Einsatz) sorgt für eine flüssige Performance, die insbesondere Anwendungen mit hohem Datendurchsatz zugutekommt. Für viele aktuelle Single-Board-Computer und ARM-Boards ist dies eine deutliche Verbesserung und hebt den Orion O6 in Sachen Geschwindigkeit und Multitasking-Fähigkeit deutlich von Einsteigerlösungen ab. Die Anschlussmöglichkeiten sind bei einem Mainboard für den Desktop essenziell und hier zeigt sich der Radxa Orion O6 als ausgesprochen gut ausgestattet. Zwei USB-C-Ports unterstützen sowohl Power Delivery als auch DisplayPort, womit sich moderne Monitore direkt anschließen lassen. Der erste USB-C-Port schafft sogar 4K bei 60 Hz, was für scharfe Bildwiedergabe sorgt.
Darüber hinaus gibt es zwei USB 3.2 Type-A Ports sowie zwei USB 2.0 Type-A Anschlüsse, die eine breite Kompatibilität mit Peripheriegeräten gewährleisten. Für eine klassische Bildausgabe gibt es HDMI mit bis zu 4K60 und DisplayPort mit bis zu 4K bei 120 Hz. Ethernet wird doppelt mit zwei 5-Gbps-Ports bereitgestellt, was besonders für Anwendungen im Netzwerkbereich interessant ist.
Ein kombinierter Kopfhörer- und Mikrofonanschluss rundet die Ausstattung ab. Im Gegensatz zu vielen anderen ARM-Systemen verfügt der Orion O6 zudem über hervorragende Erweiterungsmöglichkeiten via PCIe Gen 4. An Bord sind ein M.2 M-Key Slot mit vier Lanes für schnelle NVMe-SSDs, ein kleinerer M.2 E-Key Slot sowie ein vollwertiger PCIe x16 Slot mit acht Lanes, über den sich etwa Grafikkarten oder Netzwerkadapter anschließen lassen.
Gerade der PCIe-Slot eröffnet neue Möglichkeiten, die bislang selten auf ARM-basierten Boards zu finden waren. So hat ein Nutzer in den Radxa-Foren sogar 100-Gigabit-Netzwerkhardware über den PCIe-Slot betrieben und stabile 70 Gbit/s im Netzwerkverkehr erzielt. Doch so attraktiv die Hardware auch ist, der Orion O6 steht an der Schwelle zwischen Innovation und unvollendeter Integration. Die Firmware, die das Board steuert, weist noch diverse Kinderkrankheiten auf. Nutzer berichten von unterschiedlichen Problemen bei der CPU-Core-Verwaltung.
Während die Spezifikation offiziell 12 Kerne mit bis zu 2,6 GHz verspricht, können aktuell mit der verfügbaren SystemReady zertifizierten Firmware nur 8 Kerne aktiviert und mit maximal 2,4 bis 2,5 GHz betrieben werden. Die Firmware präsentiert die Kerne in Clustern, die von Betriebssystemen nicht optimal erkannt werden. Das führt dazu, dass Multi-Core-Anwendungen nicht die volle Leistung abrufen können. Insbesondere die Herausforderungen bei der Cluster-Topologie erschweren den effizienten Einsatz der big.LITTLE-Architektur.
Die Treiberlage ist ein weiterer Knackpunkt. Zwar ist der Orion O6 durch die SystemReady SR-Zertifizierung UEFI-kompatibel und kann problemlos Windows 11 ARM sowie verschiedenste Linux-Distributionen installieren, jedoch mangelt es noch an ausgereiften Treibern für zahlreiche Komponenten. Auf Windows-Seite fehlt etwa eine ausgereifte Treiberunterstützung für die beiden schnellen Ethernet-Ports oder die integrierte Grafikeinheit. Auch Windows-Grafikkartentreiber für PCIe-Karten sind kaum verfügbar, was die Nutzung von externen GPUs erschwert. Auf Linux-Seite sind viele Features zwar mittlerweile brauchbar, doch treten je nach Distribution noch unterschiedliche Einschränkungen und Bugs auf.
Nvidia-Grafikkarten funktionieren dank proprietärer Treiber gut, während AMD-GPUs noch Problemzonen darstellen und teilweise zu Systemabstürzen führen. Der Betriebssystemstart und die Installation verlaufen beim Radxa Orion O6 grundsätzlich unkompliziert. Windows 11 ARM lässt sich ohne aufwendige Hacks direkt installieren, was im Vergleich zu anderswo nicht selbstverständlich ist. Dennoch ist der Alltagseinsatz durch Bugs und Probleme mit der Grafik- und Netzwerktreiberunterstützung beeinträchtigt. So kann es beispielsweise vorkommen, dass der HDMI-Ausgang bei manchen Startvorgängen plötzlich in niedriger Auflösung (480p) läuft und sich nur durch einen Neustart beheben lässt.
Solche Eigenheiten machen den täglichen Gebrauch noch nervenaufreibend. In puncto Energieeffizienz zeigt der Chip ein eher durchwachsenes Bild. Die gemessene Leistungsaufnahme liegt im Leerlauf bei etwa 15 Watt, während unter Last etwa 30 Watt erreicht werden. Das ist für ARM-Systeme eher hoch, insbesondere angesichts der mobilen Herkunft der Kerne und der Verwendung von stromsparenden LPDDR5-Speicher. Im Vergleich zu Apple-M1- oder Qualcomm-Snapdragon-Chips ist die Effizienz der CPU deutlich geringer.
Benchmarks zeigen, dass der Orion O6 meist langsamer als aktuelle Apple-ARM-Systeme arbeitet und auch der Energieverbrauch größer ist. In Sachen Gleitkomma-Leistungsaufnahme (FP64 FLOPS/Watt) erreicht der Orion O6 nur knapp 1 Gflop/Watt, während beispielsweise der Raspberry Pi 5 fast das Dreifache schafft und der Apple M4 Mac Mini sogar das Siebenfache. Abseits der CPU-Leistung glänzt das Board jedoch im Bereich erweiterter PC-Funktionalität. Nutzer können das Board problemlos in Standard Mini-ITX-Gehäuse einbauen und dort dank PCIe-Erweiterung eine Vielzahl von Geräten betreiben. Das umfasst hochwertige Grafikkarten, wie die Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, die unter Linux stabil läuft und die GPU-Beschleunigung für Künstliche Intelligenz, LLMs (Large Language Models) und Gaming erlaubt.
AMD-Grafikkarten verursachen hingegen teilweise Systemabstürze, was mit aktueller Firmware und Treibern zusammenhängt und hoffentlich in Zukunft behoben wird. Amüsanterweise gibt es Berichte, dass beim Herunterfahren des Systems die Grafikkartenlüfter bei einigen Modellen unerwartet auf Volldrehzahl gehen, was als BIOS-Bug eingestuft wird. Das Thema Künstliche Intelligenz ist für den Orion O6 besonders spannend. Die eingebaute Neural Processing Unit macht das Board zu einer interessanten Plattform für neuronale Netze und maschinelles Lernen. Im Vergleich zu GPU-beschleunigten Systemen ist der SoC zwar leistungstechnisch unterlegen und verbraucht weniger Strom, aber für klein- bis mittelgroße KI-Anwendungen oder das Entwickeln und Testen von Modellen reicht die Leistung aus.
Im Vergleich mit einem Nvidia RTX 3080 Ti GPU-beschleunigten System, das bis zu 465 Watt benötigt, steht der Orion O6 mit einem Verbrauch von knapp 32 Watt jedoch deutlich zurück. Für Entwickler, die eine kompakte und stromsparende Lösung suchen, ist das Board dennoch eine interessante Alternative. Eine große Hürde für potenzielle Käufer in den USA sind aktuell die stark gestiegenen Importskosten aufgrund neuer Zolltarife. Preise, die ursprünglich bei rund 300 bis 400 US-Dollar lagen, sind durch zusätzliche Gebühren und Versandkosten bis auf 1500 US-Dollar angestiegen. Damit wird der Kauf für viele Anwender schlichtweg unattraktiv.
Für europäische oder asiatische Nutzer ist das Board preislich immer noch im mittleren Segment angesiedelt und bietet hier ein respektables Preis-Leistungs-Verhältnis. Letztendlich ist der Radxa Orion O6 ein mutiger Schritt hin zu leistungsfähigeren ARM-Desktops, der viele Türen öffnet und zwar mit deutlichen Einschränkungen. Die Hardware-Grundlagen sind hervorragend, mit starker CPU, viel schnellem RAM, exzellenter Konnektivität und PCIe Erweiterbarkeit. Die Softwareseite ist hingegen noch im Beta-Stadium und wird massiv von der Community und Radxa selbst weiterentwickelt. Für Technik-Enthusiasten, die Freude am Basteln und Optimieren haben, ist der Orion O6 ein spannendes Experiment mit viel Potenzial.