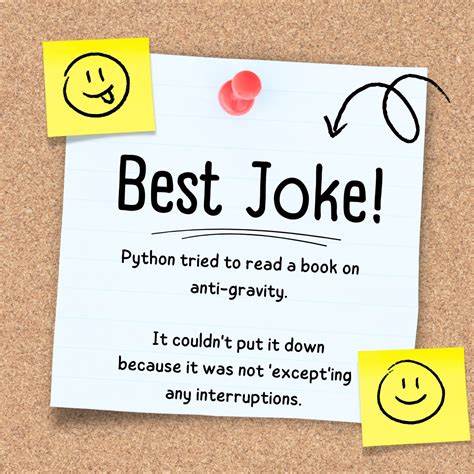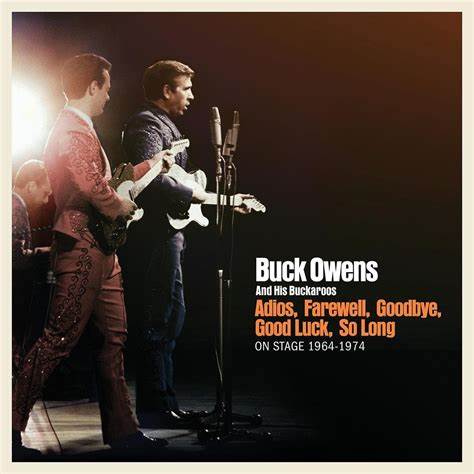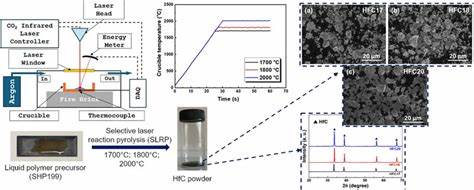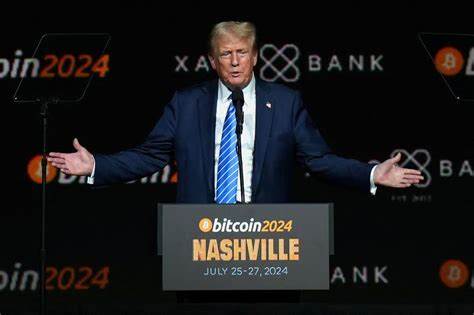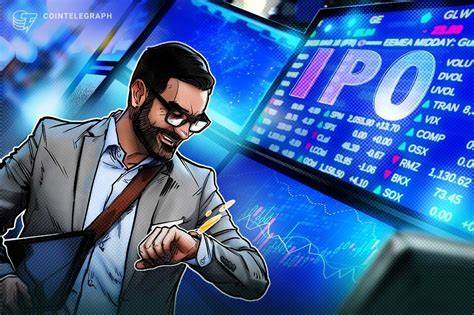Python gilt als eine der zugänglichsten und zugleich mächtigsten Programmiersprachen der Welt. Doch jeder Entwickler kennt das Gefühl, über einen unfassbar schlechten Code zu stolpern, der eher Verwirrung stiftet als Klarheit schafft. In diesem humorvollen Leitfaden entführen wir dich auf die dunkle Seite des Python-Programmierens – und zeigen auf satirische Weise, wie du den schlechtesten denkbaren Python-Code schreiben kannst. Dabei erkennst du nicht nur absurde Praktiken, sondern lernst auch, wie du es besser machen kannst. Ein wichtiger Aspekt, wenn es darum geht, schlechten Code zu schreiben, ist das bewusste Ignorieren von Klarheit.
Variable Namen wie a, b, c oder temp, data1, result und thing machen es nie einfach, den Zweck einer Funktion oder Variable zu verstehen. Die Kunst besteht darin, Namen so unverständlich wie möglich zu wählen, damit deine Nachfolger im Team oder dein zukünftiges Ich das volle Rätselspaß-Erlebnis haben. Gibt es eine Variable, die einmal einen Wert für eine Nutzer-ID hält und im nächsten Abschnitt als Zähler fungiert? Perfekt. So bleiben Verwirrung und Frustration garantiert. Wer sich wirklich Mühe geben möchte, stört den Fluss der äußeren Ordnung, indem er die Importe im Code wild verstreut.
Statt am Anfang einer Datei nur die benötigten Module zu importieren, sollten alle möglichen Bibliotheken, Pakete und Funktionen importiert werden – und das mehrfach an verschiedenen Stellen. Dadurch entsteht ein aufregendes Versteckspiel auf Teammeetings, wenn nach einem fehlenden Import gefahndet wird. Vermeide es auch, eingebaute Funktionen und Namen zu überschreiben. Das erhöht den Schwierigkeitsgrad für jeden, der versucht, den Code zu verstehen oder Fehler zu finden. Der nächste Schritt auf dem Weg zum Chaos ist das Verfassen hochkomplexer Funktionen, die alle möglichen Aufgaben gleichzeitig erledigen.
Eine Funktion, die Nutzer validiert, E-Mails verschickt, Datenbanken aktualisiert und Berichte generiert, sorgt garantiert für Übellaunigkeit. Lange Funktionskörper ohne klare Abgrenzungen oder Aufgabenbereiche erschweren die Wartung und führen zu unerwarteten Seiteneffekten. Jedes Modul wird so schnell zum Spaghetti-Code, der jede Refactoring-Aktion zu einem Glücksspiel werden lässt. Auch das Ignorieren von Fehlerbehandlung und Exceptions trägt zur Perfektion des schlechten Codes bei. Statt Ausnahmen gezielt abzufangen und sinnvoll zu behandeln, ist es effizienter, sie komplett zu ignorieren oder mit lachhaften Meldungen abzutun.
Wer braucht schon stabile Programme, wenn man stattdessen das spannende Gefühl erleben kann, dass ein System mitten im Betrieb einfach abstürzt, ohne ersichtlichen Grund? Kommentare sind einer der besten Indikatoren für lesbaren Code – oder etwa nicht? Für den schlechten Programmierer sind sie unnötig und schlicht Zeitverschwendung. Komplexe Algorithmen und verschachtelte List-Comprehensions, die niemand auf Anhieb versteht, sollten frei von Erläuterungen bleiben. Je mehr Rätselraten, desto besser. Wer braucht schon Dokumentation, wenn Verwirrung den Teamgeist stärkt? Eine der folgenreichsten Sünden ist die ausufernde Verwendung globaler Variablen. Sie verleihen jeder Funktion eine geheime Verbindung zu beliebigen Datenpunkten und machen das Verhalten des Codes schwerer vorhersehbar.
Funktionale Programmierung adé – hier ist Wildwuchs angesagt. Fehlersuche wird zu einer Schatzsuche, bei der jede Veränderung des Status irgendwo im riesigen globalen Pool von Werten liegen kann. String-Verkettungen ohne f-strings oder format-Methoden gehören ebenfalls zum schlechten Stil. Statt klarer und sicherer Formatierung wird auf einfache, aber fehleranfällige Konkatenation gesetzt, die Datenlecks wie SQL-Injection förmlich willkommen heißt. Auch wenn diese Praxis in Echtzeit für Probleme sorgt, ist sie ein Garant für dauerhaften Spaß beim Debuggen.
Leistung und Effizienz sind gerne nebensächlich. Warum Indizes in Datenbanken verwenden oder Caching-Mechanismen implementieren, wenn man mit iterativen Durchläufen über riesige Datenmengen den Server zum Schwitzen bringen kann? User müssen lernen Geduld zu haben, und dadurch wird die Hardware ordentlich ausgelastet – durchaus ein Beitrag zur Wirtschaft der Chip-Hersteller. Konfigurationen gehören nicht in eine zentrale Datei oder ein übersichtliches Setting-Modul. Stattdessen sollten sie im ganzen Code verstreut sein, idealerweise mehrfach und an unerwarteten Stellen mit unterschiedlichen Werten definiert. So stellt man sicher, dass niemand genau weiß, was gerade gilt und wann sich die Settings ändern, was den Charme der Software weiter steigert.
Die Wiederholung des gleichen Codes an mehreren Stellen ist ein weiteres unerlässliches Element des Chaos-Codings. Copy-Paste statt DRY (Don’t Repeat Yourself) sorgt dafür, dass bei Fehlern oder Änderungen unzählige Stellen modifiziert werden müssen. Dabei dürfen kleine Unterschiede im Code Fehlschläge garantieren. Jede Anpassung wird so zu einem Abenteuer voller unerwarteter Nebeneffekte und neuer Bugs. Anstatt bewährte Bibliotheken wie requests oder pandas zu verwenden, empfiehlt es sich, eigene Versionen für häufige Aufgaben zu schreiben – ob HTTP-Client oder CSV-Parser.
Auch mangelnde Pflege von Zeitzonen, Sonderfällen oder performanter Algorithmen trägt zum unschätzbaren Charme von Eigenkreationen bei. Diese lassen die eigenen Fähigkeiten erstrahlen und garantieren langfristige Problemlösungen durch unerwartete Fehler. Moderne Entwicklungswerkzeuge wie IDEs sind verpönt. Wer auf geschätzte Features wie Syntax-Highlighting, Autovervollständigung, Linting und Code-Formatierung verzichtet, erlebt das wahre Programmiererlebnis. Typo-Pannen, fehlende Imports und schlecht formatierter Code sorgen für echten Nervenkitzel und halten wach.
Debugging geschieht traditionell per print-Ausgaben, die verteilt und unfassbar sind – das motiviert zur tiefgründigen Fehlersuche und zum kreativen Denken. Auch der Einsatz von KI-gesteuerten Coding-Assistants ist tabu. Ideen, Vorschläge und automatische Code-Erstellung widersprechen dem Prinzip des Kampfes mit jedem Buchstaben. Durch das mühsame manuelle Programmieren ergeben sich wertvolle Lernmomente und echte Meisterschaft, auch wenn diese auf Kosten von Zeit und Nerven geht. Zudem bleibt die Fehlersuche zu einer echten Herausforderung und die Selbstständigkeit als Entwickler wird nie hinterfragt.
Tests sind ebenso überbewertet wie die meisten anderen Software-Qualitätssicherungsmaßnahmen. Echte Entwickler vertrauen stattdessen darauf, dass Fehler live in Produktionsumgebungen entdeckt werden. Unit-Tests oder automatisierte Integrationen sind lediglich Beschäftigungstherapie und hemmen die wahre Spannung, wenn „Karen aus der Buchhaltung“ plötzlich mit einer XXL-Datei das System zum Abstürzen bringt. All diese beschriebenen Praktiken bilden ein humoristisches Bild, das zeigt, wie man mit wenig Aufwand aber viel Kreativität den schlechtesten Python-Code schreiben kann – und warum es besser ist, diese Wege zu vermeiden. Klarheit, Struktur, Effizienz, Wartbarkeit und Dokumentation sind die Säulen guter Softwareentwicklung, auch wenn die dunkle Seite des schlechten Codes auf ironische Weise unterhält und mahnt.
Am Ende bleibt der Appell, statt schlechtem Geschmack echte Leidenschaft für sauberes Coding zu entwickeln. Für den Alltag und den Erfolg im Team sorgt Code, der verständlich, übersichtlich und robust ist. So hat niemand das Gefühl, eine Detektivarbeit zu leisten, wenn er sich in den eigenen oder fremden Projekten bewegt. Die Zukunft gehört den Entwicklern, die Humor besitzen, aber genauso wissen, wann es Zeit ist, gute Software zu schreiben – nicht nur schlechten Code.