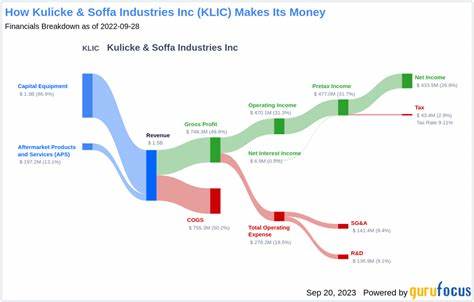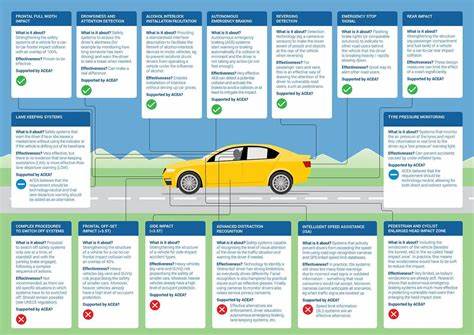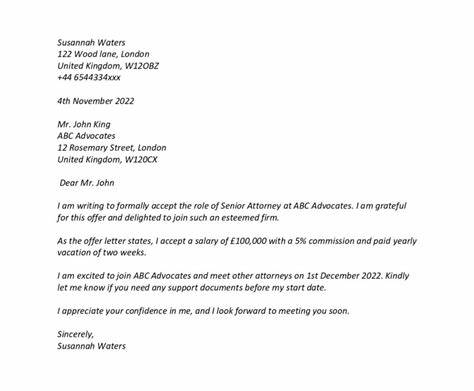Der Schweizer Biotechnologiesektor hat sich im Jahr 2024 als eine bemerkenswerte Ausnahme in einer Zeit globaler Herausforderungen für Forschungs- und Entwicklungsausgaben erwiesen. Während viele Länder weltweit einen Rückgang der Investitionen im Bereich Biotechnologie verzeichneten, konnte die Schweiz ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) auf einen neuen Rekordwert steigern. Dies verdeutlicht nicht nur die Widerstandskraft des Landes und seiner Wirtschaftsstruktur, sondern auch den hohen Stellenwert, den Innovationen und internationale Zusammenarbeit im Schweizer Biotech-Ökosystem einnehmen. Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben in der Schweizer Biotech-Branche erreichten 2024 einen Wert von beeindruckenden 2,6 Milliarden Schweizer Franken, was umgerechnet etwa 3,16 Milliarden US-Dollar entspricht. Ein bemerkenswerter Anteil davon – rund 1,4 Milliarden Schweizer Franken – stammt aus privaten Unternehmen.
Dieses Verhältnis verdeutlicht die Vitalität und das Zutrauen privater Investoren in die Wachstums- und Innovationsfähigkeit der Branche. Im Vergleich zu vielen anderen Märkten, in denen Investitionszurückhaltung und Unsicherheit für Zurückhaltung sorgen, zeigt die Schweiz damit eine stabile und zukunftsorientierte Entwicklung. Das Wachstum der F&E-Investitionen steht in engem Zusammenhang mit der Fähigkeit der Schweizer Biotechunternehmen, auf dem Kapitalmarkt Mittel zu beschaffen. Im Jahr 2024 sammelte die Branche insgesamt 2,5 Milliarden Schweizer Franken an frischem Kapital ein, was einem starken Zuwachs von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr 2023 entspricht. Dieser Zuwachs belegt nicht nur das Vertrauen der Investoren, sondern auch die Attraktivität der Schweizer Biotech-Start-ups und innovativen Firmen, die häufig noch in frühen Entwicklungsphasen agieren.
Gleichzeitig sind die Umsätze der Branche mit 7,2 Milliarden Schweizer Franken auf einem hohen, wenn auch leicht unter dem Vorjahr (7,3 Milliarden Schweizer Franken) liegenden Niveau. Diese Daten spiegeln die Balance zwischen kurzfristigen Marktschwankungen und langfristigem Innovationspotenzial wider. Die Struktur des Schweizer Biotech-Sektors ist durch eine dominierende Anzahl privater Unternehmen geprägt. Etwa 95 Prozent der Firmen sind privat und befinden sich vor allem in frühen Entwicklungsphasen. Demgegenüber stehen nur rund fünf Prozent der Firmen, die öffentlich gehandelt werden, darunter bedeutende Unternehmen wie Roche und Novartis, deren Aktivitäten die Branche prägen, aber die Diversität und Innovationskraft vor allem die Vielzahl kleinerer und mittlerer Biotech-Unternehmen stützt.
Ein erwähnenswerter Trend im Jahr 2024 ist, dass trotz der guten Privatinvestitionen keine Initial Public Offerings (IPOs) von Schweizer Biotech-Firmen stattfanden. Dies steht im Gegensatz zu den steigenden privaten Kapitalspritzen und zeigt, dass der Weg an die Börse für viele Unternehmen weiterhin herausfordernd bleibt. Die einzige Kapitalmarkttransaktion, die im Berichtsjahr verzeichnet wurde, war eine sogenannte Reverse Merger-Transaktion durch das Unternehmen Curatis. Diese Art der Fusion stellt eine Alternative zur klassischen Börseneinführung dar und bietet Firmen Chancen zur Kapitalaufnahme in schwierigen Marktphasen. Die Fokussierung auf internationale Allianzen und Partnerschaften hat sich als gewinnbringend für die Schweizer Biotech-Branche herausgestellt.
Im Zuge einer global politischen Entwicklung, die oft auf Isolationismus und nationalen Fokus setzt, präsentiert sich die Schweiz als ein überzeugendes Gegenbeispiel. Viele Schweizer Biotech-Innovatoren verfolgen nicht das Ziel, Produkte oder Technologien ausschließlich für den Schweizer Markt zu entwickeln. Stattdessen setzt die Branche konsequent auf internationale Kooperationen, was sich in mehreren hochkarätigen Partnerschaften im Jahr 2024 widerspiegelt. So ging das Basler Unternehmen AC Immune eine bedeutende Partnerschaft im Bereich der Alzheimer-Immuntherapie mit dem japanischen Pharma-Giganten Takeda ein. Ein weiteres Beispiel ist die Zusammenarbeit von Haya mit dem US-Pharmaunternehmen Eli Lilly in der Entwicklung einer Therapie auf Basis langer nicht-kodierender RNA.
Auch Basilea und Innoviva kooperierten, um die Vermarktung eines Antibiotikums voranzutreiben. Solche strategischen Allianzen ermöglichen es den Firmen, Entwicklungsrisiken zu teilen, Synergien zu nutzen und international Zugang zu Märkten zu gewinnen, was in einem hart umkämpften globalen Biotech-Umfeld entscheidend ist. Nichtsdestotrotz stellen finanzielle Herausforderungen, speziell bei kleineren Firmen, eine Realität dar. Ein Beispiel hierfür ist das Unternehmen Idorsia aus der Region Basel-Landschaft. Im Frühling 2024 unterzeichnete es einen Deal mit Viatris, der sich auf zwei Phase-III-Assets konzentrierte.
Allerdings konnte Idorsia aufgrund unzureichender liquider Mittel die vereinbarten Entwicklungskosten nicht begleichen, was dazu führte, dass der Vertrag dahingehend angepasst wurde, dass Idorsia reduzierte zukünftige Meilensteinzahlungen akzeptierte. Solche Szenarien unterstreichen die Bedeutung solider Finanzierungsstrategien und einer vorausschauenden Planung, um Innovationsprojekte erfolgreich und nachhaltig umzusetzen. Die Geschäftsführer des Schweizer Biotechnologie-Verbandes, wie Michael Altorfer, betonen die Bedeutung eines kollaborativen Modells für die Zukunft der Branche. In einer Zeit, in der vielerorts isolationistische und eigennützige Ansätze vorherrschen, positioniert sich die Schweiz mit ihrem offenen und internationalen Ansatz als attraktiver Standort für Innovation und Entwicklung. Die Idee, dass keine neue Technologie oder Produkt ausschließlich für den Schweizer Markt entwickelt wird, sondern stets für einen globalen Einsatz bestimmt ist, ist ein fundamentaler Bestandteil des Schweizer Biotech-Erfolgs.
Darüber hinaus gibt es bedeutende institutionelle Entwicklungen, die die Innovationskraft und internationale Vernetzung des Schweizer Biotech-Sektors weiter stärken. So hat die Schweizer Innovationsagentur Innosuisse die Leitung der Eureka-Initiative übernommen, einem Netzwerk von 47 Ländern und der Europäischen Kommission. Eureka unterstützt die Zusammenarbeit grenzüberschreitender Forschungsprojekte mit nicht-dilutiven Fördermitteln, also solchen, die keine Kapitalanteile der Unternehmen verlangen. Diese Förderung erleichtert Schweizer Biotechs den Zugang zu internationalen Programmen und Forschungskapazitäten. Parallel dazu spielt die Schweizer Zulassungsbehörde Swissmedic eine aktive Rolle in der sogenannten Access Consortium, einer Kooperation zur gemeinsamen regulatorischen Zulassung von pharmazeutischen Produkten in Australien, Kanada, der Schweiz, Singapur und dem Vereinigten Königreich.