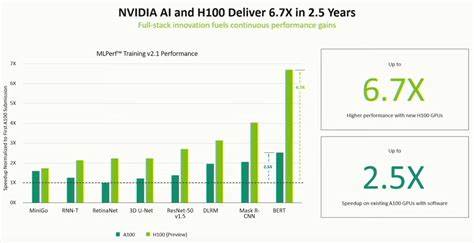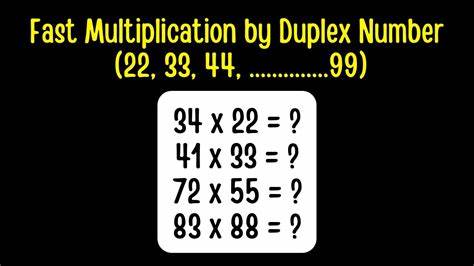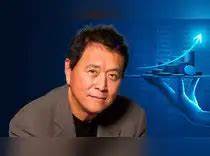Das Prinzip von mehr Dakka, ein Ausdruck, der aus der Spiel- und Militärsprache stammt und sinngemäß „mehr Feuerkraft“ bedeutet, lässt sich als Metapher auf zahlreiche Lebensbereiche übertragen. Es geht darum, dass oft nicht die einzelnen, kleinen Bemühungen oder Ansätze den größtmöglichen Effekt erzielen, sondern der wiederholte, verstärkte Einsatz, der konsequente, kontinuierliche Nachdruck. Obwohl diese Idee auf den ersten Blick simpel erscheint, ist sie in der Praxis oft schwer umzusetzen. Die Gründe dafür sind vielfältig und betreffen sowohl psychologische als auch soziale Aspekte. Mehr Dakka bedeutet, dass man über das Minimum hinausgeht, das Standardniveau durchbricht und anstatt zu resignieren oder sich mit einem halben Erfolg zufriedenzugeben, die Initiative ergreift und mehr Ressourcen – seien es Zeit, Energie, Geld oder Kreativität – in ein Projekt oder eine Lösung steckt.
Der Begriff wurde insbesondere in rationalistischen Kreisen populär gemacht, um Herausforderungen in der Gesellschaft, Forschung, Medizin und persönlicher Entwicklung zu beschreiben, bei denen das vorhandene Engagement einfach nicht ausreicht, obwohl die Wirksamkeit bewiesen ist. Ein bekanntes Beispiel dafür ist die Geldpolitik. In Japan oder Europa scheiterte die Umsetzung effektiver Inflationstendenzen oftmals daran, dass Zentralbanken nicht bereit waren, mehr Geld zu „drucken“, obwohl diese Maßnahme unter Experten als sicher und hilfreich eingestuft wird. Es fehlte an Mut oder Anreiz, das Engagement zu intensivieren, sodass die angestrebten wirtschaftlichen Ziele nicht erreicht wurden. Zwar ist Geldschöpfung nicht uneingeschränkt risikofrei, doch die Zurückhaltung führte dazu, dass Chancen ungenutzt blieben.
Ein anderes Feld, in dem sich das „Mehr Dakka“ zeigt, ist die Medizin, insbesondere bei der Dosierung von Medikamenten. Es gibt dokumentierte Fälle, in denen Patienten auf höhere Dosierungen von Wirkstoffen reagierten, ohne dass außergewöhnliche Nebenwirkungen auftraten, doch diese höheren Dosierungen wurden aus Angst oder Bequemlichkeit nicht ausprobiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass durch mehr Einsatz bessere Gesundheitsergebnisse erzielt werden könnten, wird somit verschwendet – auch wenn die Ansatzpunkte für eine Verbesserung offensichtlich sind. Ein Bereich, in dem Mehr Dakka sogar im Alltag und psychologischen Wohlbefinden eine Rolle spielt, ist die Praxis der Dankbarkeit. Studien haben gezeigt, dass das Führen eines Dankbarkeitstagebuchs die subjektive Lebenszufriedenheit erhöht.
Dennoch werden solche Praktiken von vielen kaum oder gar nicht fortgeführt, obwohl sie einfach umsetzbar sind und nahezu keine negativen Nebenwirkungen aufweisen. Das Potenzial, durch regelmäßiges und intensiveres Ausdrücken von Dankbarkeit das eigene Wohlbefinden zu steigern, bleibt ungenutzt. Die Schwierigkeiten, mehr Dakka anzuwenden, liegen nicht nur in externen Hürden, sondern oft auch in inneren Barrieren. Menschen scheuen sich davor, ungewöhnliche, soziale Normen übertretene oder riskante Schritte zu gehen. Angst vor sozialer Ausgrenzung, Statusverlust oder dem Scheitern können lähmend wirken.
Selbst wenn ein Lösungsansatz objektiv sinnvoll ist und Evidenz dafür vorliegt, blockieren solche Ängste den Fortschritt. Dadurch wird oftmals am vermeintlich sicheren Minimum festgehalten, das aber nicht ausreicht, um ein Problem endgültig zu lösen. Zudem kommt der psychologische Effekt der „symbolischen Repräsentation“. Es genügt vielen, eine halbherzige Anstrengung zu unternehmen, die das Gefühl vermittelt, der Sache gerecht zu werden, ohne tatsächlich substantiellen Fortschritt zu machen. Ein Großteil der Gesellschaft und vieler Entscheidungsträger neigt dazu, sich mit solchen symbolischen, oberflächlichen Maßnahmen zufriedenzugeben, um Verantwortung abzuschieben oder Kritik zu vermeiden.
Dieses Verhalten ist ein Klassiker sozialer Kontrollmechanismen und verhindert die nötige erhöhte Initiative. Was kann man tun, um diese Barrieren zu überwinden? Zunächst ist es wichtig, das eigene Denken dahingehend zu schulen, das Konzept des „Mehr Dakka“ bewusst zu reflektieren. Ist eine Handlung sinnvoll, kann sie durch vermehrten Einsatz nicht nur geringfügig, sondern möglicherweise exponentiell bessere Ergebnisse erzielen? Diese kritische Selbstbefragung schützt davor, zu früh aufzugeben und übt die Bereitschaft, mehr zu investieren. Gleichzeitig ist es essentiell, akzeptieren zu können, dass soziale Ängste und das Gefühl der Andersartigkeit oder Unbeholfenheit vorübergehend sind und nicht das Scheitern prognostizieren. Zum anderen macht es Sinn, sich mit dem sozialen Umfeld auseinanderzusetzen und zu ergründen, welche ungeschriebenen Regeln oder impliziten Erwartungen ein Zurückhalten von Engagement bewirken.
Oftmals reicht es schon, wenn Einzelne den Mut aufbringen, mehr zu versuchen, um eine Kettenreaktion auszulösen und Veränderungen im kollektiven Verhalten zu bewirken. Auch positive Erfolgsgeschichten sollten geteilt werden, um die Angst vor dem Risiko zu mindern und die Effektivität von „mehr Dakka“ zu belegen. Abschließend bleibt festzuhalten, dass auch „mehr“ einen legitimen Punkt findet, an dem Nutzen und Nachteile sich abwägen müssen. Es ist kein Aufruf, blind und ohne Rücksicht auf Verluste grundsätzlich mehr zu tun, sondern eine Anregung, bewusster zu prüfen, ob die Schwelle des Engagements nicht viel zu niedrig angesetzt wurde. In vielen Fällen haben Gesellschaft, Institutionen und Individuen den Punkt des ausreichenden Einsatzes sowie der Möglichkeiten zur Verbesserung weit unterschätzt.
Mehr Dakka bedeutet letztlich mehr Mut, mehr Initiative und mehr Beharrlichkeit in einer Welt, die allzu oft mit halben Lösungen vorliebnimmt.