Die Debatte um die dominierende Stellung der US-amerikanischen Zahlungsnetzwerke Visa und Mastercard gewinnt in Europa zunehmend an Bedeutung. Europas größte Einzelhändler und Online-Händler haben die Europäische Kommission darauf gedrängt, gegen die hohen und intransparenten Gebühren der beiden Marktführer vorzugehen. Diese Forderungen unterstreichen die wachsenden Spannungen zwischen europäischen Unternehmen und internationalen Zahlungssystemen, die maßgeblich den Zahlungsverkehr in der Eurozone prägen. Visa und Mastercard kontrollieren etwa zwei Drittel aller Kartenzahlungen in der Eurozone. Diese Monopolstellung ermöglicht es den beiden Unternehmen, ihre Gebühren in den letzten Jahren kontinuierlich zu erhöhen, was laut Einzelhändlern und Branchenexperten nicht durch eine entsprechende Verbesserung der Servicequalität gerechtfertigt sei.
Die Komplexität und Undurchsichtigkeit der Gebührenstrukturen erschweren es Händlern, die Kosten nachzuvollziehen oder anzufechten. Diese Situation hat zu einer wachsenden Frustration bei europäischen Unternehmen geführt, die vor allem kleine und mittlere Einzelhändler betrifft. Die hohe Belastung durch Interchange-Gebühren wirkt sich negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit aus und hemmt insbesondere neue Marktteilnehmer, die mit eigenen Zahlungssystemen versuchen, im europäischen Markt Fuß zu fassen. Im Mai 2025 veröffentlichten mehrere europäische Handelsverbände wie EuroCommerce, Ecommerce Europe und Independent Retail Europe einen offenen Brief an führende Kommissare der Europäischen Kommission. Darin fordern sie eine strengere kartellrechtliche Kontrolle sowie mehr Transparenz und Preisregulierung der so genannten International Card Schemes (ICS).
Die ICS sind internationale Zahlungskartensysteme, zu denen Visa und Mastercard gehören. Laut dem offenen Brief hat die Brattle Group im Jahr 2024 belegt, dass die Gebühren der ICS zwischen 2018 und 2022 um insgesamt 33,9 Prozent gestiegen sind. Dieser Anstieg entspricht einem jährlichen Durchschnittswert von 7,6 Prozent und liegt deutlich über der Inflation. Gleichzeitig konnten keine Verbesserungen in den Dienstleistungen für Händler oder Verbraucher festgestellt werden. Die europäische Einzelhandelsbranche sieht hierin eine klare Misswirtschaft und fordert die EU auf, regulierend einzugreifen.
Die Forderungen umfassen unter anderem die Anordnung von Höchstpreisen für Interchange-Gebühren, die Einführung von Transparenzpflichten und die Entwicklung von Kontrollmechanismen für Regulierungsbehörden. Diese Maßnahmen sollen es ermöglichen, das Geschäftsmodell der ICS besser zu durchleuchten und ein faires Wettbewerbsumfeld sicherzustellen. Die Händler warnen, dass ohne solche Eingriffe die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft langfristig geschwächt wird. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen hat die Europäische Union bereits die Einführung eines digitalen Euros als Alternative zu US-amerikanischen Zahlungssystemen in Betracht gezogen. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Abhängigkeit Europas von US-Zahlungsanbietern zu reduzieren und europäische Zahlungsdienstleister zu stärken.
Die Einführung einer eigenen digitalen Zentralbankwährung könnte die Transaktionskosten für Händler senken, den Zahlungsverkehr sicherer machen und gleichzeitig die Souveränität Europas im Finanzbereich erhöhen. Allerdings gestaltet sich der Prozess für die Einführung des digitalen Euros als langwierig und komplex, was bei vielen europäischen Politikern und Unternehmen auf Unmut stößt. Solange es keine praktikable Alternative gibt, bleiben Visa und Mastercard die dominierenden Marktteilnehmer. Dies erhöht den Druck auf die Europäische Kommission, schnell und wirksam zu handeln, um die Interessen der europäischen Wirtschaft zu schützen. Visa reagierte auf die Kritik mit dem Hinweis, dass die erhobenen Gebühren die hohen Sicherheitsstandards, den Betrugsschutz und die Zuverlässigkeit ihrer Systeme widerspiegeln.
Zudem betont das Unternehmen, dass ihre Angebote Innovationen und Verbraucherschutz zugleich fördern. Mastercard gab auf Anfragen keinen Kommentar ab. Dennoch bleibt die Kritik aus der Einzelhandelsbranche bestehen, zumal die großen Handelsketten und Online-Händler durch ihre Verhandlungsstärke vergleichsweise gut positioniert sind, die Gebühren gerechtfertigt erscheinen zu lassen, während viele kleinere Unternehmen unter den Kosten leiden. Die Unterzeichner des offenen Briefes sind namhafte Händler und Verbände wie Aldi, Amazon, Carrefour, eBay, H&M, Ikea, Marks & Spencer und weitere. Diese breite Koalition zeigt, wie ernst die Lage eingeschätzt wird und wie dringlich die Forderungen nach Regulierung sind.
Die Herausforderungen betreffen den gesamten europäischen Binnenmarkt und damit Millionen von Unternehmen und Verbrauchern, die tagtäglich auf zuverlässige und bezahlbare Zahlungssysteme angewiesen sind. Darüber hinaus steht die Situation exemplarisch für ein größeres Problem: Die Balance zwischen Innovation, Wettbewerb und Verbraucherschutz im digitalen Zahlungsverkehr ist auch eine zentrale Herausforderung der Regulierung im 21. Jahrhundert. Die Vereinigten Staaten verfügen mit Visa und Mastercard über zwei globale Champions, während Europa den Aufbau eigener, unabhängiger Zahlungssysteme erst verstärkt vorantreiben muss. Die Berichte und Forderungen der europäischen Einzelhändler werden von zahlreichen politischen und wirtschaftlichen Akteuren aufmerksam verfolgt.
Die EU-Kommission hat bereits signalisierte, die Situation zu prüfen und gegebenenfalls regulatorisch tätig zu werden. Dabei ist zu erwarten, dass kartellrechtliche Verfahren eingeleitet und neue Anforderungen an Transparenz und Preisgestaltung formuliert werden. Aufgabe der Regulierer wird es sein, einen fairen Ausgleich zu finden zwischen der Förderung technischer Innovation und der Vermeidung marktbeherrschender Übergriffe durch ICS. Die Debatte über Visa und Mastercard steht damit auch für die zunehmend komplexen Herausforderungen in einem globalisierten Wirtschaftsgefüge. Gerade im Zahlungsverkehr, der das Rückgrat des modernen Handels bildet, wird das Zusammenspiel zwischen internationalen Konzernen und europäischen Regulierungsbehörden in den kommenden Jahren eine entscheidende Rolle spielen.
Die Entwicklungen könnten darüber hinaus wegweisend sein für den Umgang mit anderen digitalen Diensten und Plattformen, die globale Märkte prägen. Für Händler, Verbraucher und politische Entscheidungsträger in Europa bleibt spannend zu beobachten, wie die EU-Kommission auf die Forderungen der Einzelhandelsverbände reagiert und welche Maßnahmen letztlich umgesetzt werden. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, den Wettbewerb im Zahlungsverkehr so zu gestalten, dass er Innovation begünstigt, Kosten senkt und gleichzeitig die Interessen aller Beteiligten schützt. Eine stärkere Regulierung von Visa und Mastercard könnte dabei den Weg bereiten zu einem gerechteren und transparenteren Zahlungsmarkt in Europa, der den Anforderungen der digitalen Wirtschaft besser gerecht wird. Insgesamt zeichnet sich ab, dass die Forderungen der Einzelhändler einen wichtigen Schritt hin zu mehr Fairness im europäischen Zahlungsverkehr markieren.
Die internationalen Kartellnetzwerke müssen sich auf verstärkte Kontrolle einstellen, während Europa seine eigene Position im globalen Wettbewerb stärken will. Für Verbraucher könnten diese Entwicklungen mittelfristig durch niedrigere Gebühren und eine vielfältigere Zahlungsmittelauswahl spürbare Vorteile bringen. Die kommenden Monate dürften daher entscheidend sein für die Zukunft des bargeldlosen Zahlungsverkehrs in Europa.



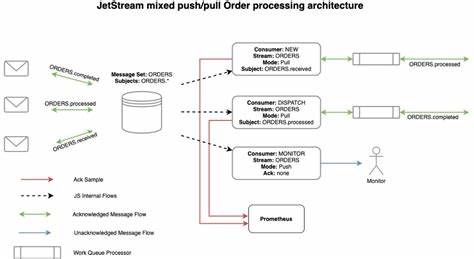



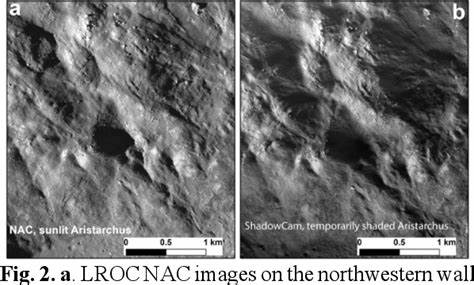
![Don't Buy Stuff from Old AI People [video]](/images/5EEE2444-655D-4E34-98EB-917D1D8D2CDF)
