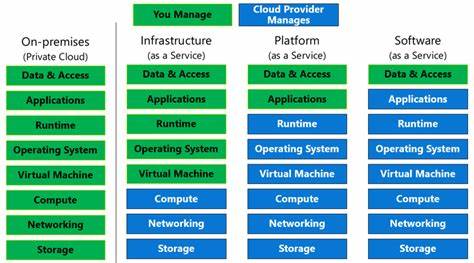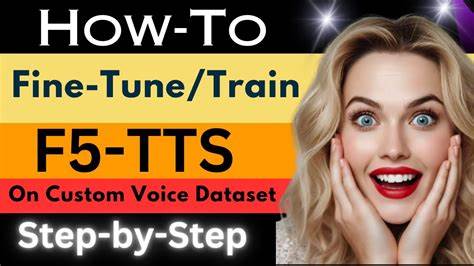Die Vorstellung, dass in den frühen 1920er Jahren bereits Taschenrechner benutzt wurden, klingt auf den ersten Blick überraschend. Schließlich verbinden viele Menschen den Begriff Taschenrechner eher mit den elektronischen Geräten der späten 20. Jahrhunderts. Die Geschichte, die sich um das im Jahr 1924 veröffentlichte mathematische Puzzle namens "Digital Difficulties" von Henry Ernest Dudeney rankt, zeigt jedoch, dass innovative technische Hilfsmittel auch damals schon zur Lösung komplexer Probleme verwendet wurden. Diese Erkenntnis beruht auf der Analyse und Veröffentlichung einer offiziellen Lösung, die im April 1924 in der bekannten Zeitschrift The Strand Magazine erschien.
Das Rätsel stellte an seine Lösungsfinder höchste Anforderungen an logisches Denken, Rechenkunst und Ausdauer, insbesondere da es sich um eine Fragestellung handelt, die das Auffinden einer neunstelligen Zahl betraf, welche bestimmte arithmetische Kriterien bis hin zur Teilbarkeit durch Zahlen von 1 bis 18 erfüllte. Bei genauer Untersuchung zeigte sich, dass das reines Probieren unpraktikabel machte. Aus diesem Grund war die Praxis, einen mechanischen Taschenrechner zu verwenden, um arithmetische Reihen systematisch zu überprüfen, nicht nur effizient, sondern notwendig. Die Lösung, die im Strand Magazine vorgestellt wurde, veranschaulicht damit nicht nur das mathematische Können der damaligen Zeit, sondern auch die frühe Nutzung von Geräten zur Unterstützung komplexer Berechnungen. Im Detail befanden sich die Schlüssel zur Lösung darin, die Eigenschaften der Zahl bezüglich ihrer letzten Ziffer, ihrer Teilbarkeit sowie der Verwendung von bestimmten Faktoren und Primzahlen systematisch zu analysieren.
Die Zahl endete demnach auf 0, ein unmissverständliches Zeichen, das zum Beispiel die Teilbarkeit durch zehn kenntlich machte. Nach dem Entfernen der letzten Ziffer, also der Division durch zehn, musste die verbleibende Zahl durch Zahlen wie 8, 9, 7, 11, 13 und 17 teilbar sein – dies orientierte sich an den größten Primfaktoren der Zahlen von 1 bis 18 unter der Berücksichtigung bestimmter Exponenten aufgrund der Division durch 10. Die Kombination dieser Bedingungen lenkte die Aufmerksamkeit auf die Zerlegung der Zahl in Abschnitte, die sich mathematisch betrachtet durch die Multiplikation mit der Zahl 1001 verbanden. Die Zahl 1001 ist dabei von besonderer Bedeutung, denn sie lässt sich als Produkt der Primzahlen 7, 11 und 13 darstellen. Die Studie der Zahlenform, die sich als Summe aus 1.
000.000 mal A, 1000 mal B und C schreiben ließ mit der Bedingung A plus C gleich B, erlaubte es, die Zahl eindeutig als Vielfaches von 1001 zu erkennen. Ergänzend sorgte die Berücksichtigung der Teilbarkeit durch 8 dafür, dass bestimmte Bedingungen auf C bestanden, der letzten dreistelligen Gruppe. Diese musste selbst ebenfalls durch 8 teilbar sein, wodurch die letzten drei Ziffern makellos jene Bedingung erfüllten. Die Auswahl dieser drei Ziffern nahm steife Gestalt an: Sie durften keine wiederholten Ziffern enthalten, kein "0" aufweisen und mussten zudem sicherstellen, dass die letzte Ziffer eine der Zahlen 2, 4, 6 oder 8 war, um die Parität und die Teilbarkeit durch 8 zu gewährleisten.
Die präzise Anzahl der solchen dreistelligen Zahlen betrug genau 56, eine verblüffende Zahl, die sich durch Kombinationen von Auswahl und Ausschluss von Ziffern ergab. Damit wurde der Forschungsraum bereits erheblich eingegrenzt. Doch es gab weitere Feinheiten zu beachten. Ein wesentlicher Punkt war, dass sich alle infrage kommenden Zahlen in Klassen unterteilen ließen, die sich jeweils durch das Hinzufügen von Vielfachen einer großen Konstanten – nämlich 153153000 – voneinander unterschieden. Diese Auswirkung führte zu einer noch feineren Systematisierung und ermöglichte es, durch die Betrachtung nur einiger weniger Fälle die Prüfung durchzuführen, ohne das gesamte Spektrum austesten zu müssen.
Dabei zeigte sich auch der Einfluss der Primfaktorfaktorisierung. Die Zahl musste eine Teilbarkeit durch die Faktoren 8, 9, 7, 11, 13 und 17 besitzen, deren LCM (kleinster gemeinsamer Vielfacher) komplexe Verknüpfungen verursachte. Durch die geschickte Nutzung des chinesischen Restsatzes und Modulo-Arithmetik reduzierte sich die Herausforderung auf überschaubare Gleichungen und Modularbedingungen. Besonders spannend war die Verwendung des modularen Inversen von 74 bezüglich 153 und wie diese mathematische Eigenschaft half, die Zahl A modulo 153 in Abhängigkeit von C direkt zu ermitteln. So wurde aus einer verwirrenden Suche eine strukturierte, algorithmische Herangehensweise.
Anhand dieses Modells konnten Systematiken gefunden werden, um automatisch passende Werte für A zu generieren. So zeigte sich, dass die ganze Lösungsmenge mit weniger als 336 Tests weitgehend abgedeckt war, viele davon parallel bearbeitbar. Zwar war diese Herangehensweise zur Zeit des Puzzles 1924 nicht mit modernen Computern ausführbar, wohl aber durch den damals innovativen Einsatz mechanischer Taschenrechner. Ihre Fähigkeit, Rechenoperationen schnell und verlässlich auszuführen, eröffnete zum ersten Mal die Möglichkeit, sich an Zahlenprobleme dieser Komplexität heranzuwagen. Heute ist diese Vorgehensweise nahezu selbstverständlich dank schneller digitaler Rechner, doch zum damaligen Zeitpunkt unterstrich sie die Vorreiterrolle der Mathematiker und Techniker, die sich auf neue Technologien stützten.
Interessant ist auch, dass diese Methode – trotz der damaligen technischen Grenzen – eine frühe Form der sogenannten „Praktischen Datenwissenschaft“ darstellt. Sie zeigt, wie man durch das Verstehen von Datenstrukturen, mathematischen Zusamenhängen und gezieltem Einsatz von Hilfsmitteln große Rechenaufwände bewältigen kann. Im heutigen Sprachgebrauch würde man diese Art von Lösung vielleicht als algorithmisch effiziente Problemlösung bezeichnen. Das Rätsel selbst ist aber viel mehr als nur eine mathematische Denksportaufgabe. Es steht auch symbolisch für den Übergang der Mathematik in die Ära der maschinellen Unterstützung, die weit über handschriftliche Exaktheit hinausgeht.
Ebenso lehrt uns die Geschichte, dass die Vereinfachung durch den Einsatz technischer Hilfsmittel nichts mit einem Verlust an Kreativität oder Intelligenz zu tun hat, sondern im Gegenteil neue Formen des Denkens und der Innovationen möglich macht. Das Puzzle „Digital Difficulties“ von Dudeney verbindet daher auf wunderbare Weise menschlichen Erfindergeist mit technologischer Unterstützung und zeigt die zeitlose Bedeutung von cleveren Ansätzen und strukturiertem Problemlösen. Wer sich heutzutage mit langen Zahlreihen, Primfaktorzerlegungen und modularen Gleichungen beschäftigt, kann aus diesem Beispiel viel lernen – nicht zuletzt, wie es möglich ist, durch tiefe Strukturanalysen komplexe Systeme zu entschlüsseln. Die Tatsache, dass schon 1924 ein Taschenrechner für ein solches Projekt eingesetzt wurde, inspiriert auch heute noch. Sie erinnert daran, wie technische Hilfsmittel die Grenzen des Möglichen verschieben und gleichzeitig Raum für noch anspruchsvollere mathematische Herausforderungen schaffen.