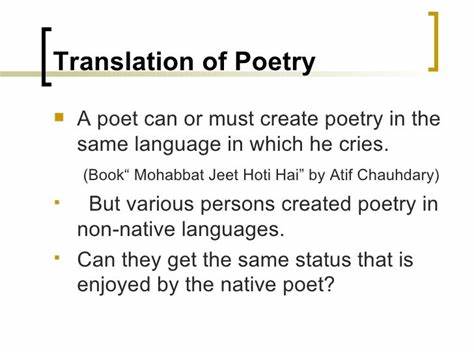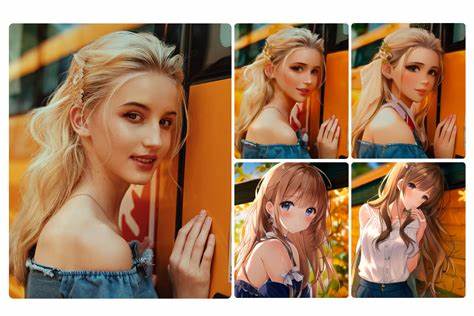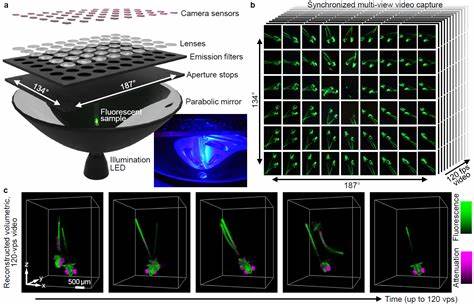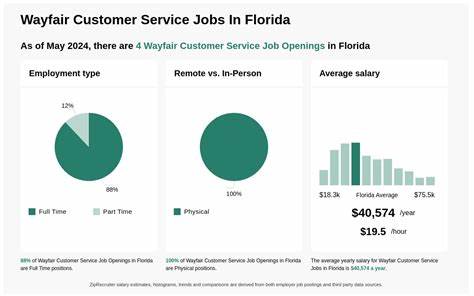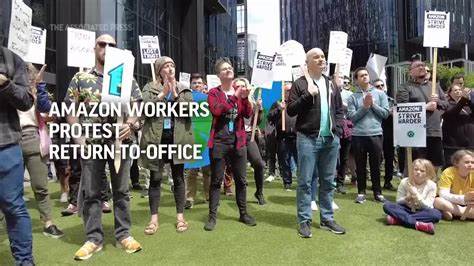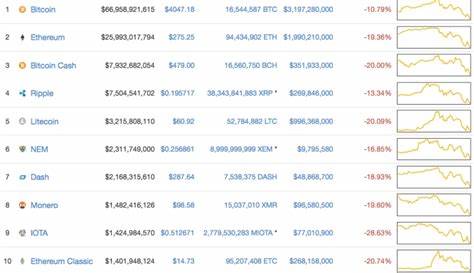Übersetzung ist seit jeher eine Brücke zwischen Kulturen und Sprachen, die es ermöglicht, literarische Schätze über Ländergrenzen hinweg zugänglich zu machen. Besonders die Übersetzung von Poesie stellt dabei eine besondere Herausforderung dar, denn sie verlangt weit mehr als die bloße Übertragung einzelner Worte. Die komplexe Verwebung von Klang, Bedeutung, Rhythmus, Tonfall und kulturellem Kontext verlangt vom Übersetzer nicht nur sprachliches Können, sondern auch künstlerisches Feingefühl und tiefes Verständnis für das Originalwerk. Ein weit verbreiteter, dennoch fragwürdiger Ausspruch, der speziell in der anglophonen Welt häufig zitiert wird, stammt angeblich von Robert Frost: „Poetry is what is lost in translation.“ Dieses Bonmot bringt eine gängige Ansicht zum Ausdruck, nach der Poesie grundsätzlich unübersetzbar sei, weil bei der Übertragung von einer Sprache in eine andere unumgänglich etwas verloren gehe.
Ähnliche Positionen finden sich bei berühmten Denkern und Dichtern wie Arthur Schopenhauer, Cesar Vallejo oder dem Linguisten Roman Jakobson. Sie sehen die Übersetzung im besten Fall als kreative Neubearbeitung, oft aber als Verrat oder Unmöglichkeit an. Doch diese Sichtweise greift zu kurz und unterschätzt die Komplexität und den Reichtum des Übersetzungsprozesses. Tatsächlich ist es so, dass zwar die tatsächlichen Worte und deren klangliche Eigenheiten nie eins zu eins übertragen werden können, aber das Gedicht keineswegs nur aus seinen Klangmustern besteht. Bedeutungsinhalte, Bildersprache, Erzählstrukturen oder Emotionen lassen sich auch in einer anderen Sprache erfahrbar machen, wenn auch auf andere Weise.
Der Übersetzer Daniel Hahn beschreibt in seinem Werk „Catching Fire“ den Übersetzungsprozess mit der Hoffnung, dass „das neue Buch keine der gleichen Worte wie das alte haben wird, aber ansonsten dasselbe Buch sein wird.“ Dieser prägnante Gedankenanstoss erinnert stark an das philosophische Paradoxon des Schiffes von Theseus. Wenn eine Vielzahl von Einzelteilen nach und nach ausgetauscht wird, bleibt das Objekt dennoch identisch. Übertragen auf Poesie heißt das, dass jedes Wort in der Übersetzung anders ist, das Werk aber in seiner Essenz und Funktion gleich bleiben kann. Das Verständnis von Übersetzung als Problem der exakten „Gleichheit“ oder „Perfektion“ ist eine trügerische mathematische Metapher, die dazu verleitet, die Übersetzung als ein unmögliches Unterfangen zu betrachten.
Stattdessen ist Übersetzen vielmehr ein künstlerischer Akt, eine schöpferische Leistung, die das Ziel verfolgt, die Wirkung des Originals in einem neuen Kontext zu erzeugen – nicht das Original wörtlich zu kopieren. Diese kreative Übersetzung bedeutet, dass immer etwas Neues entsteht. Übersetzungen sind additive Werke, die das ursprüngliche Gedicht erweitern und ihm neue Leserschichten erschließen. Das Original verschwindet nicht, sondern lebt weiter, sogar oft mit neuer Relevanz. Die Übersetzung ist keine Schwächung des Originals, sondern ein eigenständiges Kunstwerk, das „sonst das Gleiche“ ist – wie der Titel besagt.
Poeten wie Octavio Paz, Seamus Heaney oder Charles Bernstein betonen sogar eine andere Wahrheit: Poesie ist das, was in der Übersetzung gefunden wird. Übersetzen ist demnach kein Verlust, sondern eine Entdeckung. Die Suche und das Finden neuer poetischer Formen in einer neuen Sprache ist die zentrale Leistung des Übersetzens. Bernstein geht sogar noch weiter und behauptet, dass es außerhalb der Übersetzung nichts gibt. Jedes Lesen eines Gedichts ist bereits eine Art Übersetzung – eine Interpretation und Performance des Textes, die individuell immer verschieden ausfällt.
So wie ein Musiker ein klassisches Stück nicht einfach nur ausführt, sondern es interpretiert und damit neu schafft, so wird auch ein Gedicht bei jedem Lesen durch den Leser „übersetzt“. Die metaphorische Beschreibung von Übersetzung als eine Performance, eine Art musikalische Darbietung oder als das Schiff von Theseus ist dabei nicht als exakte Analogie, sondern als hilfreich zu verstehen. Sie zeigen, dass das Ziel nicht perfekte Identität ist, sondern das erfolgreiche „Übertragen“ von Essenz, Sinn und Schönheit. Etymologisch verbindet sich das Wort Übersetzung (lat. „translatio“) mit dem Begriff der Metapher (griech.
„metaphora“), der ebenfalls ein „Tragen über“ bedeutet. So gesehen ist Übersetzung im besten Fall ein poetischer Akt, der in beide Richtungen wirkt: Er nimmt das Original ernst, schafft aber zugleich etwas Neues, das nur in der fremden Sprache möglich ist. Der indische Gelehrte A.K. Ramanujan beschreibt diese Ambivalenz in einem Parabel über den Bau zweier Tunnel, die sich in einem Berg verbinden sollten.
Sollte die perfekte Verbindung scheitern, würden eben zwei Tunnel entstehen, die dennoch denselben Zweck erfüllen – einen Weg durch dasselbe Hindernis zu schaffen. Genauso ist es mit Übersetzungen. Sie müssen nicht identisch sein, um die gleiche Funktion zu erfüllen: ein Gedicht in einer anderen Sprache zugänglich zu machen und zu transportieren. Zusammenfassend zeigt sich, dass die Bedeutung von Übersetzung in der Poesie nicht in einem Nullsummenspiel von Verlust und Gewinn bestehen sollte, sondern in der Anerkennung der kreativen Leistung und der Bereicherung, die durch das Übersetzen entsteht. Die Geschichte der Literatur ist voller Beispiele dafür, wie poetische Werke durch Übersetzungen neue Leben erhalten haben und weiterhin erhalten.