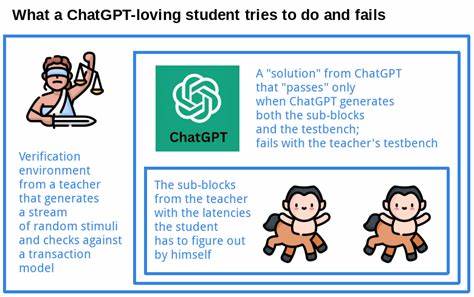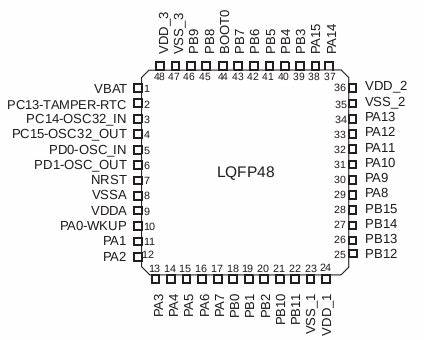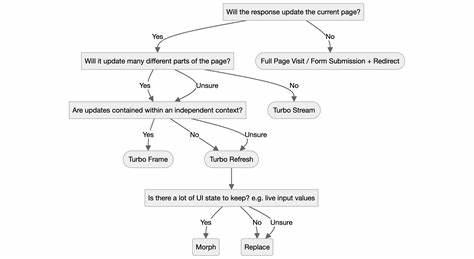In der politischen Landschaft der Vereinigten Staaten sind die Kontraste zwischen Demokraten und Republikanern oft tiefgreifend und prägend für die nationale Debatte. Ein besonders aufschlussreicher Aspekt, der in den letzten Jahren zunehmend Aufmerksamkeit erregt, ist die unterschiedliche Herangehensweise der beiden Parteien an wissenschaftliche Erkenntnisse und deren Einbindung in politische Entscheidungsprozesse. Eine aktuelle Studie, die hunderte Tausende von politischen Dokumenten analysiert hat, offenbart auffällige Diskrepanzen in der Art und Weise, wie Demokraten und Republikaner wissenschaftliche Forschung zitieren und nutzen. Demokratische Gremien und linke Denkfabriken zeigen eine deutlich höhere Neigung, Originalforschungen und wissenschaftliche Studien in ihre Arbeit einzubeziehen. Republikanische Gremien und konservative Think-Tanks dagegen beziehen sich seltener direkt auf Forschungspapiere und wissenschaftliche Quellen.
Diese Unterschiede gehen über reine Zitierhäufigkeiten hinaus und reflektieren eine grundsätzliche Differenz, wie Wissenschaft in den jeweiligen politischen Lagern bewertet und instrumentalisiert wird. Die Studie, die im Jahr 2025 veröffentlicht wurde, analysiert Akten, Anträge, Berichte und politische Stellungnahmen und vergleicht dabei, wie wissenschaftliche Erkenntnisse in den politischen Diskurs eingeflochten werden. Das Ergebnis zeigt, dass demokratisch geführte Ausschüsse im Kongress sowie linke Forschungseinrichtungen eine Wissenschaftsnähe besitzen, die sich in der exzessiven Nutzung von Primärquellen erkenntlich macht. Die Nutzung von Originalstudien bedeutet für diese Akteure oftmals eine Wertschätzung fundierter Grundlagen für politische Entscheidungen, besonders in Bereichen wie Klimawandel, öffentliche Gesundheit und Bildungspolitik. Auf der anderen Seite fällt der geringere Einsatz wissenschaftlicher Zitationen bei republikanischen Gremien und konservativen Think-Tanks oft durch eine stärkere Betonung von ideologischen oder wirtschaftlichen Argumentationslinien auf.
Dies bedeutet nicht zwangsläufig eine generelle Ablehnung von Wissenschaft, sondern häufig eine selektive Nutzung von Forschung, die innerhalb ihrer politischen Agenda verwendet wird, und eine kritische Haltung gegenüber bestimmten wissenschaftlichen Erkenntnissen, besonders wenn diese in Konflikt mit wirtschaftlichen Interessen oder traditionellen Werten stehen. Diese ungleiche Verwendung von wissenschaftlichen Quellen innerhalb der politischen Lager hat auch direkte politische Konsequenzen. Demokratische Politiker neigen eher dazu, Gesetze und Regelungen zu unterstützen, die auf evidenzbasierter Forschung beruhen, etwa im Bereich des Umweltschutzes oder der Gesundheitsvorsorge. Republikaner hingegen zeigen häufiger Skepsis gegenüber solchen Maßnahmen, besonders wenn diese mit staatlichen Eingriffen oder Regulierungen einhergehen. Diese Dynamik trägt zu einer tiefen Spaltung in der amerikanischen Politik bei und erschwert oft konsensuale Lösungen bei nationalen Herausforderungen.
Die politische Instrumentalisierung von Wissenschaft ist zudem stark mit der Medienlandschaft verknüpft. Medien, die als nah oder zugeneigt zu einer bestimmten Partei wahrgenommen werden, unterstützen oder kritisieren wissenschaftliche Positionen entsprechend. Dies führt dazu, dass wissenschaftliche Fakten in manchen Teilen der Bevölkerung unterschiedlich wahrgenommen oder gar in Frage gestellt werden – ein Phänomen, das als Polarisierung der Faktenbasis beschrieben wird. Eine weitere Dimension ist der Umgang mit internationalen wissenschaftlichen Kooperationen und Förderprogrammen. Die Studie erwähnt, dass zum Beispiel unter bestimmten konservativen Führungsebenen Initiativen wie Förderungen von Forschungseinrichtungen oder internationale Wissenschaftspartnerschaften reduziert wurden.
Dies kann langfristige Folgen für die Innovationskraft und wissenschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der USA haben. Die Hintergründe für die unterschiedliche Nutzung von Wissenschaft liegen auch in der ideologischen Verortung und der unterschiedlichen Weltanschauung der Parteien. Demokraten vertreten eher eine moderne, progressiv-wissenschaftliche Sicht, die großen Wert auf Expertentum und empirische Daten legt. Auf der anderen Seite stehen Republikaner, die traditionell mehr Wert auf Unternehmertum, individuelle Freiheit und Skepsis gegenüber bürokratischen Eingriffen legen. Diese Grundhaltung beeinflusst, welche Rolle Wissenschaft im politischen Prozess zukommt.
Im öffentlichen Diskurs ist diese Divergenz ebenfalls spürbar. Während demokratisch orientierte Bürgergruppen und Organisationen verstärkt auf Studien und wissenschaftliche Belege pochen, sind konservative Gruppen häufig misstrauischer gegenüber wissenschaftlichen Institutionen. Diese Entscheidungsmuster wirken sich auch auf den Wahlkampf und die Mobilisierung von Wählern aus, da wissenschaftliche Themen wie Klimawandel, Impfpolitik oder Bildung zentrale Streitpunkte sind. Trotz der beschriebenen Unterschiede gibt es allerdings auch Schnittmengen. In einigen Politikfeldern, etwa im Bereich der nationalen Sicherheit oder der technologischen Entwicklung, greifen beide Parteien auf wissenschaftliche Expertise zurück.
Dies zeigt, dass Wissenschaft nicht grundsätzlich parteipolitisch ausgegrenzt wird, sondern die Nutzung eher von der jeweiligen politischen Gelegenheit und Agenda abhängt. Die Erkenntnisse aus der Studie liefern wertvolle Einblicke für Wissenschaftler, politische Berater und die Gesellschaft insgesamt. Sie verdeutlichen, wie wichtig es ist, wissenschaftliche Kommunikation so zu gestalten, dass sie parteiübergreifend verständlich und zugänglich ist, um evidenzbasierte Politik zu fördern und politische Polarisierung zu vermindern. Darüber hinaus unterstreichen die Ergebnisse die Notwendigkeit, die Bildung und das Verständnis für wissenschaftliche Methodik in der breiten Bevölkerung zu stärken. Wenn mehr Menschen die Bedeutung von Forschung und den Prozess der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung nachvollziehen können, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass wissenschaftliche Fakten politisch instrumentalisiert oder missinterpretiert werden.