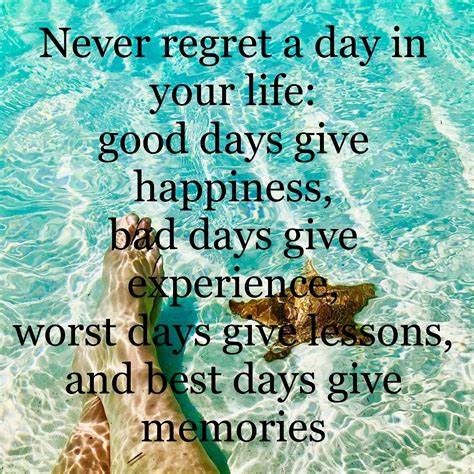Die Demokratie befindet sich im Wandel. Traditionelle Wahlsysteme, die politische Vertreter in Parlamente und Regierungen bringen, stehen zunehmend in der Kritik. Immer häufiger wird betont, dass gewählte Politiker oft nicht die Vielfalt und Lebensrealität der Bevölkerung widerspiegeln. Häufig sind sie älter, wohlhabender, männlich und gehören bestimmten gesellschaftlichen Schichten an. Vor diesem Hintergrund wächst das Interesse an alternativen Verfahren wie der sogenannten Sortition — der zufälligen Auswahl politischer Vertreter durch ein Losverfahren.
In der Geschichte ist die Sortition kein neues Konzept: Bereits im antiken Athen wurden wichtige politische Ämter auf diese Weise besetzt. Doch kann ein solches System heute wirklich bessere und vor allem gerechtere politische Entscheidungen hervorrufen? Und welche Herausforderungen gilt es zu beachten? Die folgende Betrachtung beleuchtet, warum viele eine Losentscheidung für Regierungsämter als eine interessante demokratische Innovation sehen und was dabei beachtet werden muss. Im antiken Athen war die Demokratie unmittelbar und stark geprägt von der Teilnahme der Bürger an der Politik. Die Bürgeratten versammelten sich zur Volksversammlung, debattierten über finanzielle, militärische und politische Angelegenheiten, diskutierten Gesetze und trafen Entscheidungen per Mehrheitsvotum. Wesentlich bemerkenswert war jedoch die Rolle der Losentscheidung.
Viele Ämter wurden nicht durch Wahl, sondern per Zufall vergeben. So wurde beispielsweise der Rat von Männern ausgewählt, die jeweils ein Jahr lang verschiedene Verwaltungsaufgaben übernahmen und die Tagesordnung der großen Versammlung bestimmten. Auch die Gerichtshöfe setzten ihre Geschworenen per Losverfahren ein. Diese Praxis sollte verhindern, dass sich Macht in den Händen weniger Personen oder bestimmter Gruppen konzentrierte. Die Regel des ständigen Wechsels, die sogenannte Rotation, stellte sicher, dass möglichst viele Bürger sich an der Macht beteiligten.
Indem der Staat die Amtszeit und oft auch die Vergütung sicherstellte, konnten Bürger unabhängig von ihrem sozialen Status aktiv am politischen Geschehen teilnehmen. Diese antike Praxis hat in modernen Demokratien ihre Anhänger gefunden, die argumentieren, dass der heutige Wahlsysteme der Forderung nach echter Repräsentation nicht gerecht werden. Politische Ämter bleiben häufig einer privilegierten Gruppe vorbehalten, da die Voraussetzungen für eine Wahlbewerbung erhebliche Ressourcen erfordern. Zeit, Geld und politische Netzwerke sind für viele Menschen Hindernisse. Dazu kommt, dass parteiinterne Auswahlverfahren oft Hinterzimmerpolitik fördern, und insbesondere Frauen und Minderheiten systematisch benachteiligt werden.
Die Folge ist eine Legislative, die nicht die volle Breite der Gesellschaft widerspiegelt. Untersuchungen aus Kanada zeigen etwa, dass trotz wachsender Diversität nur ein geringer Anteil von Frauen, Einwanderern und Indigenen in der Politik vertreten ist. Berufliche Hintergründe konzentrieren sich häufig auf Politik, Wirtschaft oder Jura, was die Breite der Sichtweisen einschränkt. Genau hier setzt die Sortition an. Sie verspricht eine „beschreibende Repräsentation“ — die Zusammensetzung der politischen Gremien soll sich stärker an der soziodemografischen Struktur der Bevölkerung orientieren.
Anstelle eines „Klubs der Millionäre“ könnte eine zufällige Selektion dazu führen, dass auch Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten, Altersgruppen oder Lebenssituationen politische Ämter übernehmen. Denkbar ist, dass in einem solchen Parlament Vertreter säßen, die wirklich die Sorgen der Mehrheit teilen — etwa junge Menschen, die von der Wohnungsnot betroffen sind, oder Menschen, die soziale Leistungen beziehen. Tatsächlich sprechen sich Experten dafür aus, das Prinzip der Rotation wieder zu beleben, um den Einfluss von Geld und Interessenverbänden zu begrenzen und gleichzeitig die Qualität der politischen Debatte zu erhöhen. Die Kommerzialisierung politischer Kampagnen und die Menge an bezahlter Werbung, vor allem auf digitalen Plattformen wie Facebook, prägen oft die öffentliche Meinungsbildung auf problematische Weise. Falschinformationen, polarisierende Wahlkampfstrategien und die Konzentration auf oberflächliche Schlagworte führen zu einer Entfremdung vieler Bürger vom politischen Prozess.
Sortition eröffnet einen Weg, Politik wieder als gemeinschaftliche Aufgabe wahrzunehmen. Politische Entscheidungen werden dabei von Bürgern getroffen, die sich intensiv mit den Themen auseinandergesetzt haben, ohne den Druck der Wahlkampfmechanismen oder der Parteiordnungen. Dies könnte zu fundierteren, faktenbasierten Entscheidungen führen. Ein praktisches Beispiel für die Anwendung von Losverfahren in der Politik bieten Bürgerforen und -versammlungen, wie sie etwa in Kanada durchgeführt wurden. 2003 wurde in British Columbia eine Bürgerversammlung ins Leben gerufen, die sich mit der möglichen Reform des Wahlsystems beschäftigte.
Über 150 Bürger wurden zufällig unter Berücksichtigung von Alter und Geschlecht ausgewählt und kamen über mehrere Tage zusammen, um verschiedene Wahlsysteme kennenzulernen, zu diskutieren und zu bewerten. Dabei wurden sie von Experten betreut und erhielten eine Aufwandsentschädigung. Nach intensiver Debatte stimmte die Mehrheit für das sogenannte Single Transferable Vote (STV) System. Obwohl dies bei einem Referendum nicht angenommen wurde, zeigte das Experiment, dass Bürger ohne vorherige politische Erfahrung anspruchsvolle Meinungsbildung leisten können. Ähnliche Bürgerversammlungen fanden in Ontario und anderen Ländern statt.
In Irland beispielweise konnte eine Bürgerversammlung durch öffentliche Transparenz und mediale Begleitung wichtige gesellschaftliche Veränderungen anstoßen. Sie empfahl die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe und die Aufhebung restriktiver Abtreibungsgesetze. Beide Vorschläge wurden in Folge vom Volk bestätigt, was wiederum zeigt, dass Sortitionsverfahren mit öffentlicher Kommunikation demokratische Akzeptanz erreichen können. Natürlich ist die Umsetzung eines maßgeblichen Regierungswechsels per Los nicht unumstritten und mit Herausforderungen verbunden. Die von Sortition ausgewählten Personen sind selten vollständig repräsentativ hinsichtlich aller Aspekte, da einzelne Menschen nicht alle Facetten einer Gruppe abdecken können.
Zudem sind Akzeptanz und Verantwortlichkeit gegenüber der breiten Öffentlichkeit wichtige demokratische Prinzipien, die nicht vernachlässigt werden dürfen. Die fehlende Wahlbarkeit und potenzielle mangelnde Rechenschaftspflicht von zufällig ausgewählten Politikern sind kritische Punkte. Auch besteht die Gefahr, dass bei Versammlungen ein „gemeinwohlorientierter“ Konsens angestrebt wird, der die Interessen von Minderheiten oder marginalisierten Gruppen nicht ausreichend berücksichtigt. Viele Befürworter schlagen daher hybride Modelle vor, in denen Sortition neben traditionellen Wahlsystemen existiert. So könnte etwa eine Kammer im Parlament aus zufällig gewählten Bürgerinnen und Bürgern bestehen, die neben einem gewählten Parlament wichtige Aufgaben übernehmen.
McGill-Politikwissenschaftler Arash Abizadeh plädiert dafür, Institutionen wie den kanadischen Senat durch solche Kammern mit zufälliger Besetzung zu ersetzen — mit einer Neuinterpretation des demokratischen Prinzips der Repräsentation und der politischen Rotation. Andere Ideen sehen Losentscheidungen in einem enger gefassten Mandat vor, etwa bei der Reform von Wahlgesetzen oder bestimmten Politikbereichen. Damit Sortitionsverfahren demokratisch akzeptiert und wirksam werden können, ist die Kommunikation zu und mit der Bevölkerung entscheidend. Übertragungen, ausführliche Berichterstattung und ein begleitender öffentlicher Diskurs erhöhten in Irland den Zulauf zu den Reformen. Gleichzeitig ist es wichtig, Bürgerinnen und Bürger in die Lage zu versetzen, sich aktiv und informiert an politischen Prozessen zu beteiligen — nicht nur jene, die ausgelost wurden.
Bildung, transparente Abläufe und finanzielle Anreize für politische Beteiligung sind wichtige Voraussetzungen, um die politische Teilhabe insgesamt zu stärken. Zusammenfassend zeigt die Debatte rund um das Losverfahren als demokratisches Werkzeug eine spannende Rückbesinnung auf alte Prinzipien, verbunden mit modernen Herausforderungen. Während traditionelle Demokratien unter Problemen wie überrepräsentierten Eliten, verminderter politischer Teilhabe und oberflächlicher Diskursführung leiden, vermittelt die Sortition Hoffnung auf ein inklusiveres und partizipativeres System. Die gewonnene Diversität und die Möglichkeit für alle Bürger, aktiv an der Politik mitzugestalten, könnten das Vertrauen in demokratische Institutionen erhöhen und neue Impulse setzen. Dennoch ist klar, dass Sortition keine Wundermethode ist, die alle Probleme der Demokratie lösen kann.