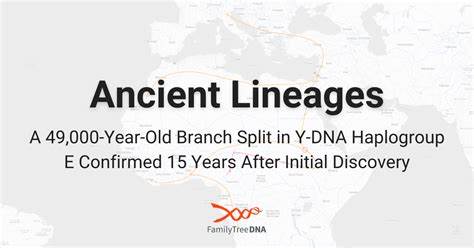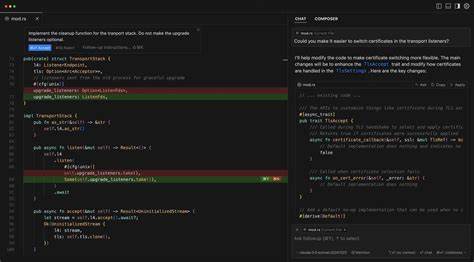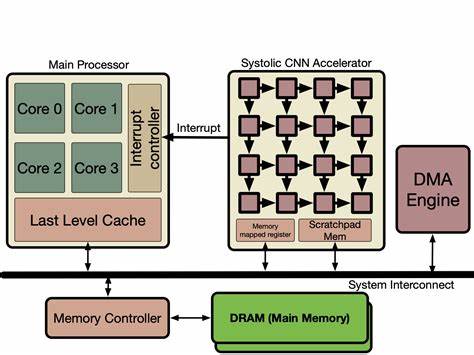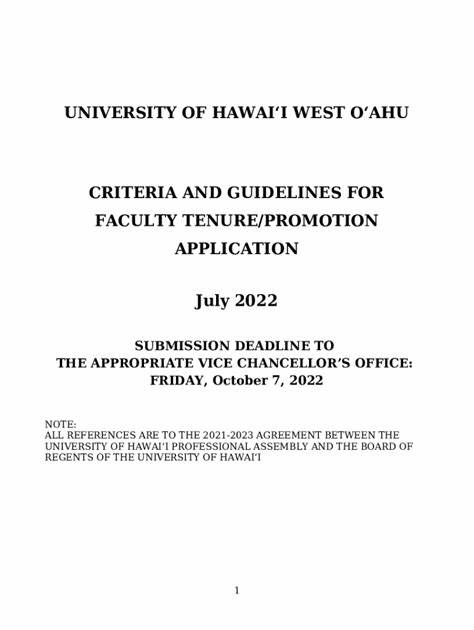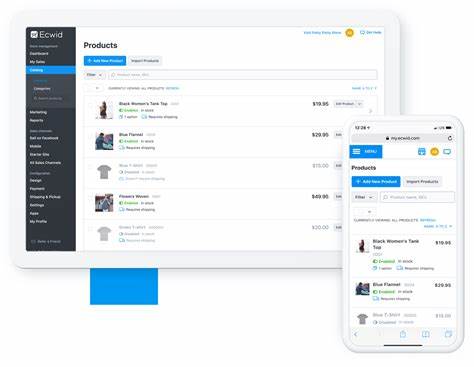Die Sahara, heute eine der trockensten und lebensfeindlichsten Wüstenregionen der Erde, war vor tausenden von Jahren eine grüne, savannenartige Landschaft mit zahlreichen Wasserquellen, die menschliche Besiedlung und frühe Viehzucht ermöglichten. Diese Gegend, die sogenannte Grüne Sahara, erlebte während des Afrikanischen Feuchtzeitraums (African Humid Period, AHP) zwischen etwa 14.500 und 5.000 Jahren vor heute eine fundamentale ökologische und kulturelle Transformation. Archäologische Funde und Umweltveränderungen bestätigen, dass Menschen dort gejagt, sammelten und schließlich Vieh hielten.
Bis heute war jedoch vieles über die genetische Geschichte jener menschlichen Populationen unklar, da die Extrembedingungen und der Altersfaktor die DNA-Erhaltung stark beeinträchtigen. Die jüngste Veröffentlichung bahnbrechender Forschungsergebnisse zu antiker DNA aus der zentralen Sahara im Takarkori-Felsunterstand im Südwesten Libyens bringt nun Licht in eine bislang verborgene Vergangenheit und deckt eine bis dato unbekannte, tief verwurzelte nordafrikanische genetische Linie auf. Dies eröffnet neue Perspektiven auf die Herkunft und Entwicklung der Bevölkerungen Nordafrikas und der umgebenden Regionen. Die entdeckten Genome stammen von zwei weiblichen Individuen, die um die 7.000 Jahre alt sind, aus der Pastoral-Neolithischen Periode.
Die Analyse zeigt, dass ihre genetische Herkunft auf eine Linie zurückzuführen ist, die sich frühzeitig vom Rest der afrikanischen Populationen abzweigte und über lange Zeit isoliert blieb. Überraschenderweise verbindet sie eine enge genetische Nähe zu Jäger- und Sammlergruppen aus Taforalt, einer Höhle in Marokko mit etwa 15.000 Jahren Alter, die mit der Iberomaurusischen Lithikindustrie assoziiert wird. Diese Verbindung verweist auf eine beständige Population, die Nordafrika prägte, lange bevor das Neolithikum in die Region eintraf. Die Datenauswertung zeigt, dass es wenig bis keine signifikante genetische Vermischung zwischen den populären Gruppen Nordafrikas und den sub-saharischen Populationen während der Afrikanischen Feuchtzeit gab.
Obwohl ökologisch die Sahara zu dieser Zeit grüner und durchlässiger für Wanderungen gewesen sein sollte, weisen die genetischen Spuren auf weitgehende Isolation und damit auf strenge Barrieren hin, die den Austausch von Menschen gen Norden und Süden hemmten. Diese Ergebnisse widersprechen frühere Vorstellungen, die eine verstärkte Durchmischung und Migration zwischen den Regionen während des klimatisch günstigen Zeitfensters nahelegten. Eine zentrale Debatte betraf die Frage, ob die Ausbreitung des Pastoralismus in der Sahara durch kulturellen Austausch oder durch tatsächliche Wanderungsbewegungen von Menschen, insbesondere aus dem Nahen Osten und dem Levante-Raum, erfolgte. Die Analyse der DNA aus Takarkori legt nahe, dass kulturelle Diffusion, also die Verbreitung von Ideen, Techniken und Innovationen, eher der dominierende Faktor war, da die genetische Signatur der herdenhaltenden Bevölkerung kaum Levante-Anteile aufweist. Dies hebt den Fokus auf sozio-kulturelle Prozesse hervor, durch die Techniken wie Viehzucht angenommen und adaptiert wurden, ohne dass große menschliche Migrationen stattfanden.
Darüber hinaus offenbart die Forschung bemerkenswerte Details zur komplexen Genetik der antiken Nordafrikaner. So tragen die untersuchten Individuen eine seltene mitochondriale Haplogruppe N, welche eine der ältesten Linien außerhalb Subsaharas darstellt und tief in die Zeit der frühen menschlichen Auswanderungen aus Afrika hineinreicht. Die weitere Untersuchung archaischer DNA zeigt außerdem, dass die Menschen der Grünen Sahara nur sehr geringe Anteile an Neandertaler-DNA besitzen – weit weniger als zeitgleich lebende Menschen im Nahen Osten – was auf eine lange Isolation und eine frühe Abzweigung ihrer Vorfahren hindeutet. Die Datenauswertung stützte sich auf modernste genetische Techniken, die trotz der schwierigen Erhaltungsbedingungen in der Sahara eine umfangreiche Rekonstruktion der Genome ermöglichten. Die Entnahme und Analyse erfolgte sorgfältig in hochspezialisierten Laboren, wobei innovative Verfahren zur Anreicherung relevanter genetischer Marker angewandt wurden.
Die gesamte Methodik erlaubte es, präzise Vergleiche mit zahlreichen anderen antiken und heutigen Populationen durchzuführen und so ein robustes Bild der genetischen Landschaft zu zeichnen. Im Regionalvergleich stellt die genetische Nähe zwischen den Takarkori-Funden und den populationen aus Taforalt und anderen nordwestafrikanischen Fundorten eine Brücke zu den ältesten bekannten menschlichen Gruppen in Nordafrika her. Daraus lässt sich schließen, dass bereits vor dem African Humid Period eine beständige nordafrikanische Bevölkerung existierte, die sich tief von den sub-saharischen und nahöstlichen Gruppen unterschied und deren genetisches Erbe bis heute in einigen Bevölkerungen, darunter den Fulani in der Sahelzone, nachgewiesen werden kann. Die Studie liefert damit wichtige Erkenntnisse zur Rolle der Sahara als genetische Barriere. Trotz phasenweise günstiger klimatischer Bedingungen und Vegetationszunahme hinderte die Sahara den Austausch von Genen über große Zeiträume hinweg.
Diese Abschottung trug wesentlich zur heute beobachteten genetischen Differenzierung zwischen Nord- und Subsahara-Afrika bei. Ökologische Fragmentierung und kulturelle Faktoren spielten hierbei eine zentrale Rolle. Die Feststellung, dass auch während der Feuchtzeit keine bedeutende Genfluss zwischen den Arten stattfand, unterstreicht die Bedeutung geografischer und sozialer Grenzen in der menschlichen Evolutionsgeschichte. Die Erkenntnisse haben auch Auswirkungen auf das Verständnis der individuen-, aber auch der gesellschaftlichen Dynamik jener Frühzeit. Die Takarkori-Frauen gehörten zu einer Population, deren demografische Größe auf einige tausend Individuen geschätzt wird, ohne Zeichen enger Inzucht.
Dies spricht für langlebige Gemeinschaften mit komplexen sozialen Strukturen, die sich in ihrer materiellen Kultur und Subsistenzformen von Jägern und Sammlern zu ersten Nutzviehhaltern wandelten. Die Entwicklung von Pastoralismus war damit womöglich ein gradueller Prozess kultureller Innovation und Integration, weniger ein Resultat massiver Bevölkerungsverschiebungen. Schlussendlich stellt die Arbeit auch einen Aufbruch für künftige Forschungen dar. Sie demonstriert, wie tiefgründige Einblicke in antike Bevölkerungen auch jenseits der bislang gut erforschten Regionen möglich sind. Weitere Analysen kompletter Genome, breiterer Proben, und verbesserter Datierungsmethoden werden das Bild der Menschheitsgeschichte in Afrika weiter verfeinern können und uns helfen, Migrations- und Kulturentwicklungslinien besser zu verstehen.
Die Grüne Sahara gilt somit nicht nur als Ökozone vergangener Zeiten, sondern als Schlüsselregion, deren Genetik uns einzigartige Fenster in die komplexe Vergangenheit Nordafrikas und der Menschheit öffnet.