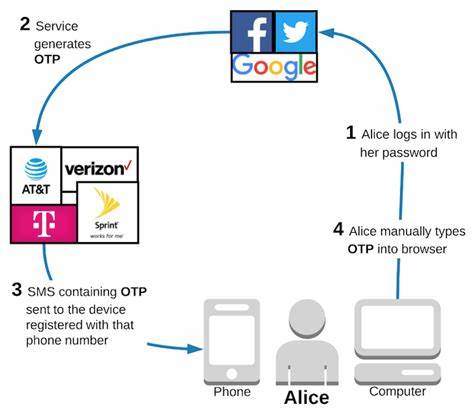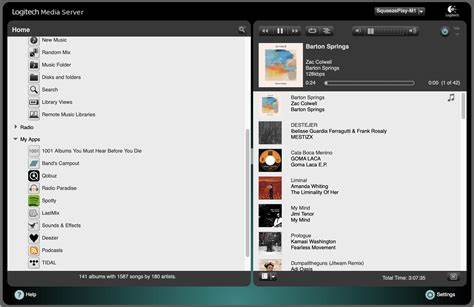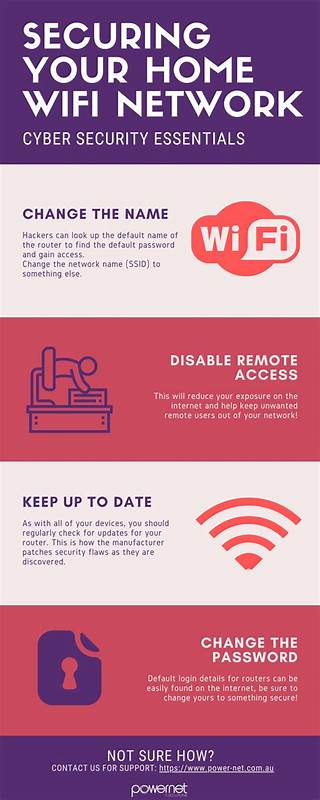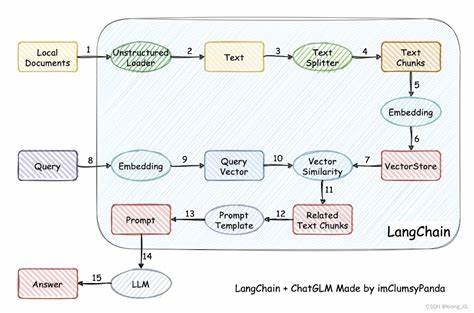Programme nehmen in der sozialen Systemtheorie von Niklas Luhmann eine herausragende Rolle als strukturelle Elemente ein, die Entscheidungen leiten und die Komplexität moderner Gesellschaften ordnen. Betrachtet man Programme als zentrale Werkzeuge, die verschiedene gesellschaftliche Funktionssysteme miteinander verbinden und auf deren Logiken aufbauen, eröffnet dies ein umfassendes Verständnis für die Organisation von Kommunikationsprozessen und individuellen sowie kollektiven Handlungsorientierungen. Dabei werden Programme nicht nur als technische oder organisatorische Instrumente verstanden, sondern als symbolische Ordnungen, die Leitdifferenzen sozialer Systeme hervorbringen und stabilisieren. Sie fungieren als Schnittstellen zwischen Organisationen und den umfassenderen Codes gesellschaftlicher Subsysteme und sind somit unverzichtbar für die Kommunikation und Koordination in komplexen sozialen Wirklichkeiten. Ihre Bedeutung reicht weit über traditionelle klassische Vorstellungen von Programme hinaus und umfasst auch die aktuellen Herausforderungen und Transformationen, die sich durch die allgegenwärtige Digitalisierung ergeben.
Im Zentrum steht die Frage, wie Programme als architektonische Strukturen innerhalb sozialer Systeme beobachtet, analysiert und verstanden werden können. Hierbei geht es um die Differenzierung von Programmierung und Codierung, Konzepte, die Luhmann als wesentlich für die Strukturierung sozialer Ordnungen beschreibt und die die Möglichkeit eröffnen, einen dritten Wert, also eine weitere Differenzierungsebene, sichtbar zu machen. Programme ermöglichen es, soziale Entscheidungen innerhalb festgelegter Rahmungen zu treffen, indem sie definieren, unter welchen Bedingungen bestimmte Handlungen als richtig oder falsch, profitabel oder verlustreich gelten. Dadurch schaffen sie Ordnungen, die nicht nur rational nachvollziehbar sind, sondern auch moralische und kulturelle Präferenzen widerspiegeln. In diesem Sinne fungieren Programme als Vermittler zwischen organisationsinternen Prozessen und externen gesellschaftlichen Erwartungen oder Funktionscodes wie Wirtschaft, Recht, Politik oder Wissenschaft.
Besonders interessant ist die Perspektive, dass Programme zugleich die soziale Aufmerksamkeit steuern, indem sie bestimmen, was im Mittelpunkt steht und was als Randerscheinung fungiert. Diese Selektion ist von entscheidender Bedeutung, denn sie lenkt die Wahrnehmung und Interpretation gesellschaftlicher Phänomene und beeinflusst somit auch soziale Macht- und Hierarchiestrukturen. Programme schaffen und erhalten nicht nur Ordnungen, sie sind auch maßgeblich daran beteiligt, Inklusion und Exklusion zu produzieren. Sie entscheiden darüber, welche Akteure, Informationen oder Themen in Kommunikationsprozesse einbezogen werden und welche ausgeschlossen bleiben. Dies zeigt, dass Programme eng mit sozialen Machtverhältnissen und ideologischen Ausschlüssen verbunden sind und als Instrumente der sozialen Differenzierung und Hierarchisierung wirken.
Die soziale Differenzierung selbst, ein Kernkonzept der Luhmannschen Theorie, kann durch Programme in verschiedenen Formen realisiert werden: segmentarisch, zentriert-peripher, funktional oder stratifikatorisch. Diese vier grundlegenden Differenzierungsformen werden durch Programme unterschiedlich kodiert und gesteuert, was ihren Einfluss auf unterschiedliche gesellschaftliche Ordnungen verdeutlicht. Dabei ist hervorzuheben, dass die Programme selbst eine Art Metacodierung darstellen können, die übergeordneten Prinzipien der Inklusion und Exklusion, der Relevanz und Präferenziertheit steuern. Die Entwicklung der Programme vor dem Zeitalter der digitalen Technologien erlaubt einen historischen Blick auf ihre Funktionsweisen, während zugleich die digitale Transformation neue Facetten und Herausforderungen mit sich bringt. Mit der zunehmenden Durchdringung aller Lebensbereiche durch digitale Technologien gewinnen Programme im Sinne von Softwarealgorithmen und Codes an Bedeutung und durchdringen sowohl die analoge als auch die digitale Kommunikationswelt.
Diese Verschmelzung von Programmen als symbolischen Strukturen und als technischen Apparaten schafft eine komplexe Wechselwirkung, die in der reflexiven Beobachtung sozialer Systeme besondere Aufmerksamkeit verdient. Die Tatsache, dass beispielsweise Texte oder Entscheidungen heute teilweise durch künstliche Intelligenz generiert werden – also durch Programme, die selbst soziale Systeme beeinflussen – unterstreicht diese neue Dimension programmatischer Steuerung. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie soziale Systeme auf die Automatisierung und algorithmische Differenzierung reagieren und welche neuen Programmformen sich dadurch herausbilden. Die Erforschung und theoretische Reflexion der Programme erfordert daher eine multidisziplinäre Herangehensweise, die sozialtheoretische Konzepte mit Erkenntnissen aus den Digitalwissenschaften und der Ethik verbindet. Auch der Blick auf unterschiedliche globale Perspektiven, etwa Beiträge aus dem globalen Süden oder kritische Positionen, erweitert das Verständnis, da Programme als soziale Phänomene stets kontextgebunden und damit kulturell und ideologisch beeinflusst sind.
Programme wirken somit zugleich als technologische Realitäten, soziale Konstruktionen und kulturelle Praktiken, deren dynamische Beziehungen untersucht werden müssen. Die systemtheoretische Analyse öffnet darüber hinaus Raum, Programme als kommunikative Adressen und Addressees zu betrachten, das heißt als Elemente, die sowohl aussenden als auch empfangen, was wichtige Implikationen für die soziale Kommunikation hat. Programme unterscheiden sich ferner erheblich zwischen organisierten Gesellschaften und Gesellschaften von Organisationen, wodurch neue Differenzierungen und Herausforderungen für soziale Ordnungen entstehen. Politische Programme, gesundheitsbezogene Interventionen oder Bildungsprogramme illustrieren zudem, wie Programme als gezielte soziale Eingriffe wirken und hierbei normative Ordnungen etablieren oder verändern. Die ideologischen Funktionen von Programmen sind ebenfalls nicht zu vernachlässigen.
Sie können Hierarchien der Relevanz festschreiben oder infrage stellen, wobei sie zu einem wichtigen Gegenstand kritischer gesellschaftlicher Analysen werden. Abschließend lässt sich feststellen, dass die Untersuchung von Programmen im Rahmen der sozialen Systemtheorie von Niklas Luhmann einen entscheidenden Beitrag zum Verständnis von Komplexität, Differenzierung und Steuerung moderner Gesellschaften liefert. Die Luhmann-Konferenz 2025 in Cambridge bietet eine wichtige Plattform, um diese Fragestellungen interdisziplinär zu vertiefen und sowohl klassische als auch innovative Zugänge zu diskutieren. Der interaktive Austausch von Beiträgen, die traditionelle sozialtheoretische Perspektiven mit zeitgemäßen digitalen Herausforderungen verbinden, kann wesentliche Impulse für die weitere Forschung und Praxis liefern. So eröffnen sich neue Einsichten in die Rolle von Programmen nicht nur als linguistische oder administrative Anordnungen, sondern als tiefgreifende soziale Strukturen, die das gesellschaftliche Leben prägen, steuern und transformieren.
Somit bildet die Reflexion über Programme eine Brücke zwischen theoretischer Analyse und empirischer Forschung, die für das Verständnis und die Gestaltung der zunehmend digitalisierten und komplexen Gesellschaft von essenzieller Bedeutung ist.
![Programmes. Observed with social systems theory [CFP]](/images/04F4ABE5-4ECE-4952-A566-71AB4F0301AF)