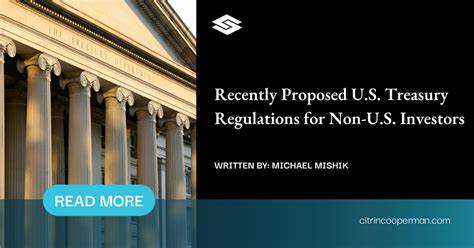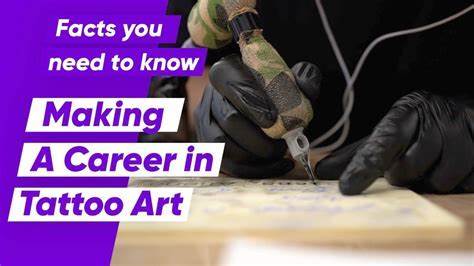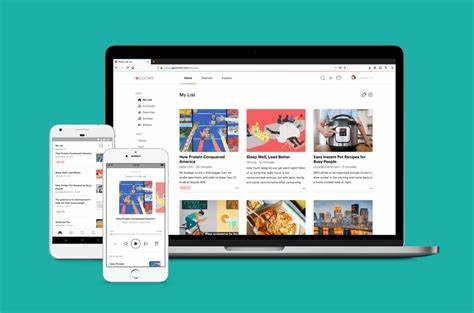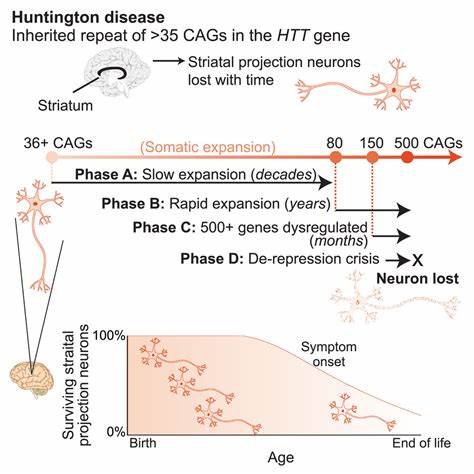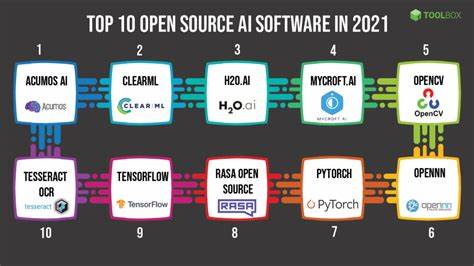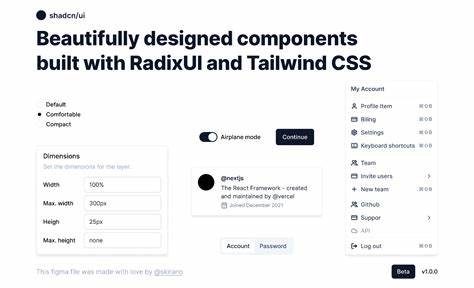Der Pianocorder Reproduzierer ist ein bemerkenswertes Beispiel für die technologischen Innovationen im Bereich der selbstspielenden Klaviere während der späten 1970er Jahre. Entwickelt von Superscope, wurde dieses System auch unter dem Namen Marantz Reproducing Piano angeboten. Die Besonderheit des Pianocorders liegt in der Verwendung von gewöhnlichen Kassettenbändern als Speichermedium, was in der damaligen Zeit eine neuartige und gleichzeitig äußerst praktische Lösung darstellte. Dabei läuft das Kassettenteil doppelt so schnell wie herkömmliche Kassetten – mit 3,75 Zoll pro Sekunde –, um eine höhere Datenbandbreite zu gewährleisten und somit feinere musikalische Nuancen aufnehmen zu können. Die gesamte Klavier-Performance wird in 128-Bit-Datenframes verschlüsselt, die etwa 35-mal pro Sekunde abgespielt werden.
Im Gegensatz zu modernen Player-Piano-Systemen wird der Datenstrom dabei nicht zuerst in einen Zwischenspeicher geladen. Stattdessen erfolgt die Decodierung und Steuerung der Klavierelemente in Echtzeit direkt vom Kassettensignal, mithilfe von Zählern, Schieberegistern und anderen logischen Bausteinen. Eine Veränderung des Tempos gelingt durch die einfache Anpassung der Bandgeschwindigkeit – eine unkomplizierte und wirkungsvolle Methode, die eine flexible Interpretation ermöglicht. Ein wesentlicher Unterschied gegenüber späteren, hochmodernen Systemen liegt in den Expressivitätsparametern. Während heutige Reproduktionssysteme wie Yamaha Disklavier oder QRS Pianomation die polyphone Anschlagintensität für jede einzelne Taste getrennt steuern, setzt der Pianocorder auf eine Aufteilung der Tastatur in zwei Hälften: Bass und Diskant.
Für jede Hälfte werden die Lautstärke und Dynamik durch fünfbitige Intensitätswerte eingestellt, die alle Töne in der jeweiligen Region gleichermaßen beeinflussen. Diese Idee erinnert stark an die pneumatischen Player-Pianos der 1920er Jahre, ist aber durch die digitale Codierung deutlich präziser reproduzierbar. Obwohl diese technische Einschränkung zunächst simpel erscheint, ermöglicht sie doch eine beeindruckende Annäherung an polyphone Artikulation, indem benachbarte Frames unterschiedliche Intensitäten erzeugen können. So entsteht für das menschliche Ohr der Eindruck differenzierter Ausdrucksnuancen. Die Reichweite des Pianocorders umfasste etwa 80 Tasten sowie die Steuerung der weichen und Sustain-Pedale, was das musikalische Ergebnis deutlich lebendiger gestaltete als einfache Player-Piano-Wiedergabesysteme.
Die Idee und das entwickelte System fanden großen Anklang, was auch die Zusammenarbeit von Superscope mit QRS bezeugt. Gemeinsam wurde eine umfangreiche Sammlung von Musikbändern aufgelegt – mehr als 350 Kassetten à 40 Minuten –, welche sowohl historische Klavierrollen in digitalisierte Form übersetzten als auch eigens von bekannten Pianisten wie Liberace, Oscar Peterson oder George Shearing eingespielt wurden. Diese Künstler nutzten ein spezielles Master-Klavier von Superscope, um originale Reproduktionen mit höchster Qualität zu schaffen. Mit der Verbreitung des Pianocorder-Systems setzte eine Welle von Innovationen ein, die eine neue Ära mechanischer Musikwiedergabe einläuteten. Die Vermarktung erfolgte breit gefächert in den USA, wobei ein eigens produziertes Tonband mit Marketingpräsentationen an Klavierhändler verschickt wurde.
Dieses Werbematerial betonte die Bedeutung des Pianocorders als „wichtigstes neues Produkt der Musikindustrie der letzten 50 Jahre“ und hob die Kombination aus musikalischer Präzision und fortschrittlicher Technik hervor. Trotz der damaligen hohen Wertschätzung gab es im Laufe der Jahre technische Herausforderungen, die durch die stetige Weiterentwicklung der Elektronik und der digitalen Datenspeicherung späterere Systeme zu beheben versuchten. Besonders der Verzicht des Pianocorders auf eine Zwischenspeicherung und damit eine gewisse Flexibilität in der Wiedergabe war ein Merkmal, das im Zeitalter moderner Computertechnologie seine Grenzen zeigte. Dennoch ist der Pianocorder historisch gesehen eine wichtige Brücke zwischen den mechanischen Player-Pianos des frühen 20. Jahrhunderts und den heutigen elektronisch gesteuerten Klavier-Reproduktionssystemen.
In den letzten Jahrzehnten entstanden diverse Upgrade-Kits, welche die ursprüngliche Kassettendeck-Funktion ersetzten und moderne Steuerungen über Computer, Tablets oder Smartphones ermöglichten. Diese Nachrüstungen machten den Pianocorder zukunftsfähig, indem sie ihn mit digitalen Musikformaten kompatibel machten und so beispielsweise das Abspielen von MIDI- und ESEQ-Dateien ermöglichten. Ein populäres Plug-in für den Winamp-Player erlaubt es Nutzern heute, ihre Pianocorder über PC-Software zu steuern und mit allerlei zeitgemäßer Software zu kombinieren. Auch eine Community von Enthusiasten, Besitzern und Technikern hat sich rund um den Pianocorder gebildet und bietet ein Forum für den Erfahrungsaustausch, Wartungshinweise und technische Hilfestellungen. Sogar spezielle Justagebänder im MP3-Format ermöglichen eine praktische und einfache Pflege des Systems, besonders für die kalibrierten Pedal- und Tasten-Solenoide.
Die Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation, Service-Anleitungen und eine Liste von Fachtechnikern zeigen die anhaltende Relevanz und Pflege dieses faszinierenden Instruments. Der Pianocorder gilt heute als Kulturgut und technisches Denkmal einer Zeit, in der Musik und Mechanik in einer innovativen Symbiose standen. Die Bemühungen zur digitalen Archivierung und MIDI-Übersetzung der umfangreichen Pianocorder-Musikbibliothek unterstreichen die Wichtigkeit, diese akustischen Aufnahmen und historischen Daten auch für kommende Generationen zu erhalten. Insgesamt stellt das Pianocorder-System ein bemerkenswertes Zeugnis für die Fortschritte der Musikreproduktion dar. Es verbindet Vintage-Technik mit wegweisender Digitalisierung und ist auch heute noch ein faszinierendes Kapitel in der Geschichte mechanischer Musikinstrumente.
Interessierte profitieren von der lebendigen Community, zahlreichem technischem Material und der Möglichkeit, das System an moderne Technologien anzubinden. So bleibt der Pianocorder weit mehr als nur eine nostalgische Erinnerung – er ist ein einzigartiges Stück musikalischer Innovation mit Zukunftspotential.