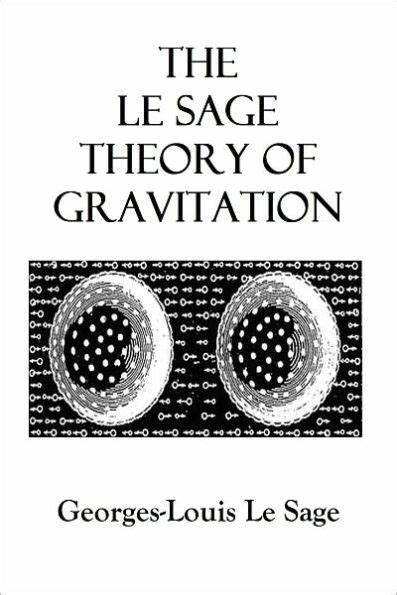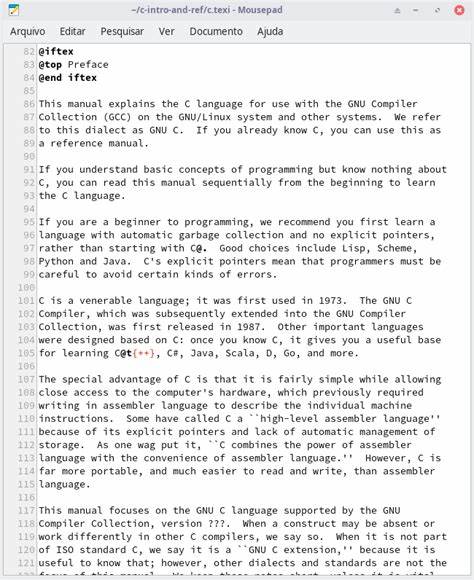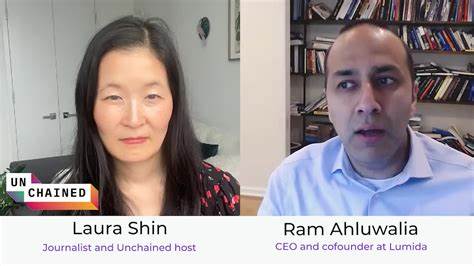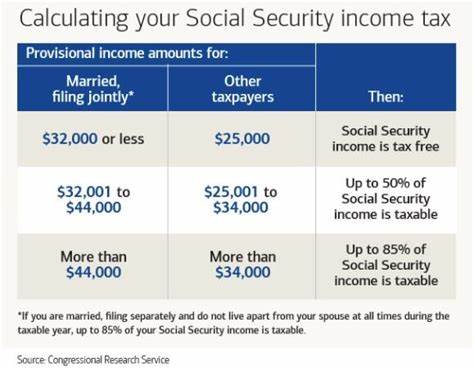Le Sage's Theorie der Gravitation stellt einen faszinierenden Versuch dar, das Phänomen der Schwerkraft auf mechanischem Wege zu erklären. Ursprünglich von Nicolas Fatio de Duillier im Jahr 1690 vorgeschlagen und später von Georges-Louis Le Sage weiterentwickelt, zielt die Theorie darauf ab, die Anziehungskraft zweier Körper durch den Einfluss winziger, unsichtbarer Teilchen zu erklären, die als ultra-mundane Korpushkeln bezeichnet werden. Diese Teilchen strömen angeblich mit hoher Geschwindigkeit aus allen Richtungen auf die Materie ein und bewirken durch gegenseitiges Abschirmen zwischen Körpern eine Druckdifferenz, welche als "Schubkraft" gedeutet wird und so die beobachtete gravitative Anziehung hervorruft. Die Grundidee dieser Theorie beruht auf einem einfachen, aber originellen Konzept: Einzelne Körper werden isotrop von diesen Teilchen getroffen, sodass sich die Kräfte im Gleichgewicht aufheben und keine Netto-Kraft entsteht. Trägt man jedoch zwei Körper in das System ein, so schirmen sie einander gegenseitig von der Partikelstrahlung ab.
Aufgrund dieser gegenseitigen Abschirmung entstehen ungleiche Druckverhältnisse, welche letztlich die Körper aufeinander zu bewegen – eine Art "Schattenspiel" auf kosmischer Ebene. Diese Erklärung wird gelegentlich auch als "Schubgravitation" oder "Schattengravitation" bezeichnet. Ein zentraler Aspekt der Theorie ist die Annahme, dass die Kollisionen zwischen den ultra-mundanen Teilchen und den körperlichen Materieteilchen nicht vollständig elastisch ablaufen. Vollständig elastische Stoßprozesse würden eine Rückstrahlung mit gleicher Intensität zur Folge haben, die die Abschirmwirkung negieren würde. Daher postuliert Le Sage, dass die Teilchen nach den Zusammenstößen verlangsamt oder energetisch abgeschwächt werden, um so die notwendige Druckdifferenz für die Gravitation zu erzeugen.
Ein weiterer Nachweis für die Konsistenz der Theorie ist das Auftauchen des invers-quadratischen Abstands-Gesetzes. Aufgrund der Verteilung der Teilchenstrahlung auf einer sphärischen Oberfläche und der Zunahme dieser Oberfläche mit dem Quadrat des Radius, nimmt die Kraftwirkung proportional zum Kehrwert des Quadrats des Abstands ab. Somit wird mit Le Sage's Modell eine fundamentale Eigenschaft der Gravitation, die Newtonsche Gravitationsgesetz, anschaulich erklärt. Vor allem bei der Proportionalität zur Masse erschienen Schwierigkeit. Da die gravitative Wirkung zunächst proportional zur Fläche eines Körpers wäre, musste Le Sage annehmen, dass die Materie eine extrem durchlässige Struktur besitzt: einzelne Elementarteilchen sind winzig und weit voneinander entfernt, sodass die Teilchenstrahlung diese ungehindert durchdringen kann, um ihre Abschirmung proportional zur Gesamtmasse zu gewährleisten.
Historisch ist zu erwähnen, dass Le Sage's Gravitationstheorie nie breite Akzeptanz fand. Obwohl physikalisch faszinierend, blieben zahlreiche Probleme ungelöst, weshalb die Theorie nach der Entwicklung der allgemeinen Relativitätstheorie Einsteins größtenteils in Vergessenheit geriet. Dennoch prägte der Gedanke mechanischer Erklärungen für Gravitation eine lange Phase der wissenschaftlichen Auseinandersetzung und wurde von verschiedenen bedeutsamen Wissenschaftlern wie Euler, Laplace oder Kelvin diskutiert. Vor allem die Problematik des Energiehaushaltes machte der Theorie zu schaffen. Da die ultramundanen Teilchen bei jedem Stoß Energie an die Materie verlieren müssten, würde dies zu einer massiven Aufheizung von Körpern führen, die in der Realität jedoch nicht beobachtet wird.
Versuche, dieses sogenannte "Wärmeproblem" durch Annahmen über innere Energiezustände der Teilchen zu lösen, blieben unzureichend. Darüber hinaus hätte die ständige Beschleunigung oder Abbremsung von Körpern durch die Teilchenstrahlung zu unerwünscht messbarem Widerstand geführt – der sogenannte "Drag-Effekt" – welcher mit bekannten präzisen Beobachtungen insbesondere im Sonnensystem unvereinbar ist. Eine weitere Kritik bezieht sich auf den Widerspruch mit der Relativitätstheorie, denn Le Sage's Modell benötigt für eine physikalische Konsistenz Korpushkeln, die sich mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen müssten, was nach moderner Physik nicht möglich ist. Hier zeigt sich die tiefe Kluft zwischen mechanistischen Gravitationsmodellen und dem heutigen Verständnis von Raum, Zeit und Masse. Fatio de Duillier hat bereits im 17.
Jahrhundert die theoretischen Grundlagen gelegt; allerdings wurde seine Arbeit erst über hundert Jahre später von Le Sage erweitert und popularisiert. Zwischenzeitlich beschäftigten sich Wissenschaftler wie Gabriel Cramer oder Franz Albert Redeker mit ähnlichen Ideen, welche die Basis für die Le Sage'schen Überlegungen bildeten. Newton selbst äußerte ambivalente Meinungen zu Fatio's Vorschlag, wohl einerseits beeindruckt von der Eleganz der mechanischen Erklärung, andererseits skeptisch bezüglich der Umsetzung. Neben dem Grundmechanismus gab es zahlreiche Weiterentwicklungen und Abwandlungen der Theorie durch spätere Forscher im 19. Jahrhundert.
Lord Kelvin beispielsweise versuchte, das Wärmeproblem mit der Vorstellung zu umgehen, dass die Teilchen ihre kinetische Energie in innere Moden umwandeln könnten. J.J. Thomson, Lorentz und andere stellten Vorschläge zur Einbindung elektromagnetischer Strahlung anstelle der ultramundanen Teilchen auf. Trotz dieser Bemühungen konnten die gravierenden Grundprobleme der Theorie nicht beseitigt werden.
Moderne physikalische Erkenntnisse, insbesondere aus der Quantenfeldtheorie und der Allgemeinen Relativitätstheorie, machen klar, dass Le Sage's Ansatz nicht mit dem heutigen Verständnis der Gravitation vereinbar ist. Die Gravitation wird mittlerweile als Geometrisierung der Raumzeit interpretiert, wobei keine mechanischen Teilchen als Träger der Kraft postuliert werden müssen. Zudem zeigen präzise Experimente zur Äquivalenzprinzipprüfung und Messungen von Gravitationswellen, dass die Einsteinsche Theorie äußerst robust ist. Dennoch bleibt Le Sage's Theorie ein wichtiges historisches Beispiel für die Suche nach einer mechanischen Erklärung physikalischer Kräfte. Sie verdeutlicht die Bemühungen früher Naturphilosophen, Naturerscheinungen mit anschaulichen Modellen nachvollziehbar zu machen, sowie die Grenzen solcher Hypothesen in Abgrenzung zu der heutigen mathematisch-formalen theoretischen Physik.
Interessanterweise hat das Konzept der ultramundanen Teilchen und deren Auswirkungen auf Materie auch in nichtgravitationsbezogenen Bereichen Anwendung gefunden. In der Plasmaphysik beispielsweise wurde Ähnliches bei der Erklärung von Anziehungs- und Abstoßungskräften zwischen Staubteilchen diskutiert. Auch in der Kosmologie wurden sogenannte "mock gravity"-Effekte untersucht – theoretische Anziehungskräfte infolge von Strahlungsabsorption, basierend auf dem Grundgedanken von Strahlungsschatten in einem Medium. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Le Sage's Gravitationstheorie trotz ihrer historischen Bedeutung und anschaulichen Mechanik unter den starken Einschränkungen leidet, die sich aus theoretischen Widersprüchen und experimentellen Befunden ergeben. Die notwendige Existenz unvorstellbar energetischer, schneller und durchlässiger Teilchen stellt Anforderungen an das Modell, die über die heute akzeptierten physikalischen Grundsätze hinausgehen.
Doch die kreative Idee, Gravitation durch einen Impulsmechanismus zu erklären, bietet wertvolle Einsichten in die Entwicklung physikalischer Denkmodelle und macht die Geschichte der Gravitationserklärung um eine spannende Facette reicher.