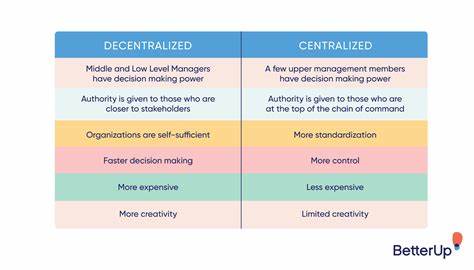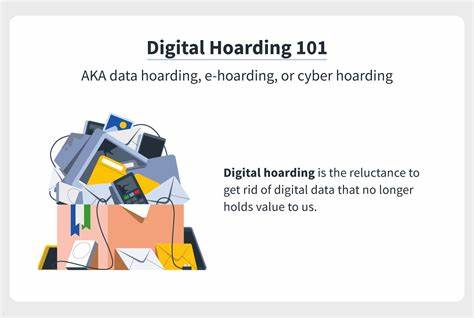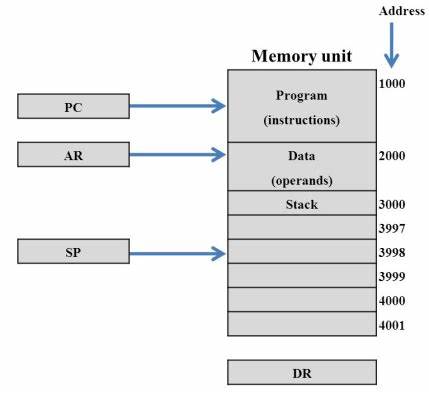Lehrkräfte, die in Kathmandu in öffentlichen Schulen Englisch unterrichten, stehen vor einer Reihe einzigartiger Herausforderungen, die das Lernen stark beeinflussen. Die Schülerinnen und Schüler, die dort unterrichtet werden, kommen oft aus den sozial und wirtschaftlich schwächsten Schichten Nepals. Besonders auffällig und zugleich berührend ist die Tatsache, dass viele dieser Kinder mit Bleistiften zur Schule kommen, die kürzer als die Handfläche eines Kindes sind. Diese kleinen Details sind Zeugnisse des täglichen Kampfes von Familien, die mit sehr begrenzten Mitteln versuchen, ihren Kindern Bildung zu ermöglichen. Die Eltern dieser Schülerinnen und Schüler verdienen ihr Einkommen meist durch tägliche Lohnarbeit, wie etwa auf Baustellen, als Rikscha-Fahrer oder auf Märkten mit dem Verkauf von Gemüse.
Für sie ist Bildung ein hohes Gut, das sie ihren Kindern trotz großer finanzieller Belastungen ermöglichen möchten. Obwohl der Staat die monatlichen Schulgebühren übernimmt, kommen weitere Kosten für Schulmaterialien wie Bleistifte, Radiergummis und Hefte hinzu, die sich für Familien mit geringem Einkommen schnell summieren. Viele Kinder betreten daher den Klassenraum mit verkürzten Bleistiften und oft ohne ausreichend Schulmaterial, doch ihre Entschlossenheit und Lernfreude sind ungebrochen. Der Begriff „Erstgenerationenschüler“ spielt hier eine wichtige Rolle, denn er beschreibt jene Schüler, deren Eltern keinen Schulabschluss haben. In Nepal bedeutet das häufig, dass die Eltern noch nicht einmal die Grundschule abgeschlossen oder überhaupt keinen Zugang zu Schulbildung hatten.
Diese Tatsachen prägen nicht nur die familiäre Umgebung, sondern auch die Haltung der Kinder gegenüber Bildung und deren Zugang. Lehrkräfte, die selbst Erstgeneration sind, entwickeln ein besonderes Verständnis und eine tiefe Verbundenheit zu ihren Schülerinnen und Schülern. Oft stehen sie vor der Herausforderung, Englisch als lebendige Sprache zu vermitteln und nicht bloß als Schulfach, das auswendig gelernt werden muss. Diese Differenzierung ist essenziell, damit die Kinder nicht nur Vokabeln und Grammatikmechanismen auswendig lernen, sondern tatsächlich beginnen, die Sprache zu sprechen und zu verstehen. Das Erlernen von Englisch in dieser besonderen Umgebung ist kein linearer, schneller Prozess.
Selbst nach zwei Jahren regelmäßigen Unterrichts ist fließendes Englisch für viele Schüler noch nicht Realität. Dieser Umstand rührt allerdings nicht von fehlendem Einsatz oder Fähigkeit, sondern vielmehr von den sozioökonomischen Umständen und den strukturellen Herausforderungen her, die das Lernen erschweren. Der Unterricht wird von einer flexiblen und einfühlsamen Herangehensweise geprägt, die auf die Bedürfnisse und Energielevel der Schüler eingeht. Leitende Prinzipien sind Spaß am Lernen und das aktive Zuhören, um den Unterricht an die Interessen der Kinder anzupassen. Kreativität und Interaktivität sind wichtige Methoden, um die Motivation hochzuhalten.
Theater, Wortspiele und Reimübungen helfen, die Hemmungen beim Sprechen abzubauen und fördern die Sprachentwicklung auf spielerische Art. Besonders beliebte Methoden sind Rollenspiele und Charades, bei denen anfangs schüchterne Murmeln langsam zu vollständigen Sätzen anwachsen. Spaß und Bewegung verbinden sich so mit dem Lernen, was in einem Umfeld, das durch knappe Ressourcen geprägt ist, unerlässlich ist. Die Durchführung von Theaterstücken stellt oft eine gewisse organisatorische Herausforderung dar, da viele Schüler gleichzeitig auf die Bühne wollen. Doch diese Dynamik trägt zur Begeisterung bei und stärkt das Selbstbewusstsein der Teilnehmer.
Trotz aller Bemühungen ist das Niveau der Schüler weiterhin heterogen. Einige können sich bereits fließend vorstellen und einfache Sätze bilden, während andere noch Schwierigkeiten mit Grundstrukturen wie Subjekt-Verb-Objekt haben. Dies verdeutlicht, wie viel Geduld und individuelle Förderung nötig sind, um die Entwicklung jedes einzelnen Kindes voranzutreiben. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Unterrichts ist das kontinuierliche Beobachten und Zuhören, was hilft, die Lerninhalte flexibel zu gestalten und bei Bedarf anzupassen. Die Arbeit mit diesen Kindern zeigt eindrücklich, wie Bildung nicht nur ein Werkzeug für persönliche Entwicklung und soziale Mobilität darstellt, sondern auch ein Zeichen von Hoffnung und Durchhaltevermögen ist.
Die Schülerinnen und Schüler kommen Woche für Woche trotz aller Widrigkeiten in die Schule, mit ihren kürzesten Bleistiften und dem unerschütterlichen Willen, es noch einmal zu versuchen. Die Lehrerinnen und Lehrer teilen diese Ausdauer und Motivation, was eine besondere Lerngemeinschaft schafft, die von gegenseitigem Respekt und einem gemeinsamen Ziel geprägt ist. Die sozioökonomischen Umstände der Familien und der strukturelle Bildungsnotstand Nepals verdeutlichen, dass die Vermittlung von Englisch weit über das reine Lehren von Sprache hinausgeht. Sie ist ein Kraftakt, der das Potenzial hat, Türen zu öffnen – zu weiterführender Bildung, besseren Arbeitsmöglichkeiten und einem verbesserten Leben. In einer globalisierten Welt bietet Englisch als Weltsprache den Zugang zu Informationen, die oft nur in dieser Sprache verfügbar sind, und erweitert somit den Horizont derjenigen, die sie beherrschen.
Aus der Perspektive der Lehrkräfte in Kathmandu wird deutlich, dass es nicht allein um Perfektion oder flüssiges Sprechen geht, sondern um das schrittweise Vorankommen und das Bewusstsein, dass Lernen ein Prozess mit Höhen und Tiefen ist. Die tägliche Realität ist geprägt von Herausforderungen, die nicht sofort gelöst werden können, aber durch konsequentes Engagement und kreative Ansätze der Lehrenden gemildert werden. Für Pädagoginnen und Pädagogen weltweit, die ähnliche Bevölkerungsgruppen unterrichten, weist die Erfahrung aus Kathmandu darauf hin, wie wichtig es ist, Empathie und Flexibilität in den Vordergrund zu stellen und den Unterricht an die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler anzupassen. Die Verwendung von Spielen, Liedern und interaktiven Übungen kann, selbst in ressourcenarmen Settings, große Fortschritte bewirken. Zusammenfassend zeigt die Arbeit mit Erstgenerationenschülern in Kathmandu eindrucksvoll, wie Bildung trotz aller materiellen Einschränkungen ein kraftvolles Werkzeug für gesellschaftliche Veränderung sein kann.
Die kürzesten Bleistifte in den Händen der Kinder symbolisieren nicht nur den Mangel an Ressourcen, sondern vor allem den unbeirrbaren Willen zum Lernen und zur Integration in eine zunehmend globalisierte Welt. Die Lehrerinnen und Lehrer, die diesen Weg begleiten, tragen mit Zuversicht und Innovationsgeist dazu bei, dass dieser Wille nicht erlischt, sondern wächst – Tag für Tag, Woche für Woche, auch wenn das fließende Englisch noch ein fernes Ziel bleibt.