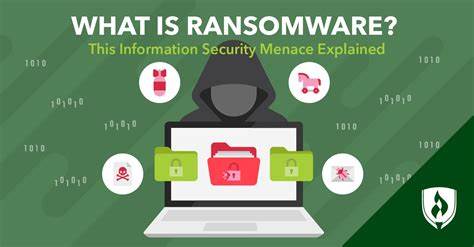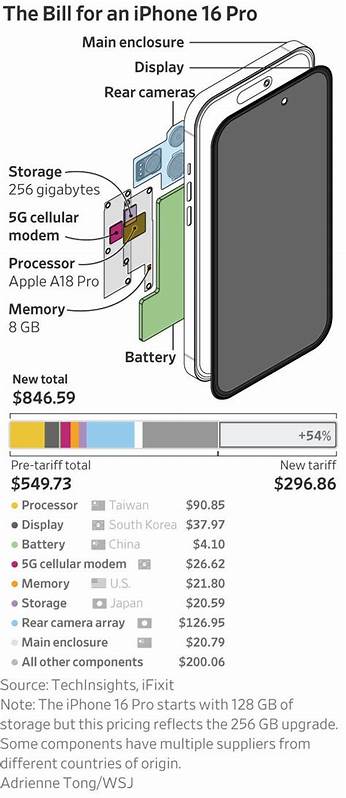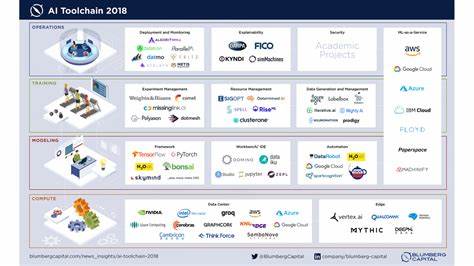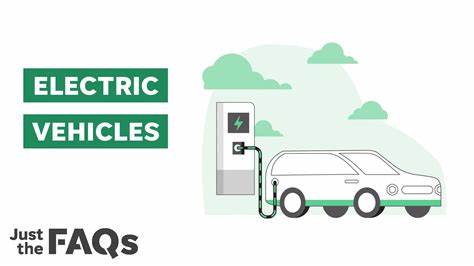Die Polizei in Milwaukee steht vor einer wegweisenden Entscheidung, die sowohl Chancen für die Verbrechensbekämpfung als auch erhebliche Bedenken bezüglich Datenschutz und Überwachung mit sich bringt. Geplant ist ein Tauschgeschäft: Die Übergabe von rund 2,5 Millionen Fotos aus Haftakten an das Unternehmen Biometrica, das im Gegenzug die Gesichtserkennungssoftware kostenlos bereitstellen würde. Diese Technologie soll den Ermittlern helfen, Verbrecher schneller zu identifizieren und Fälle effizienter zu lösen. Die Verantwortlichen der Milwaukee Polizei sind überzeugt, dass der Einsatz dieser Technologie die Aufklärungsrate von Straftaten erheblich verbessern und den Druck auf die Ermittler reduzieren kann. Laut Aussagen der Polizeiführung soll die Gesichtserkennung jedoch niemals als alleiniges Beweismittel dienen, sondern nur ergänzend verwendet werden, um Verdächtige zu identifizieren, die bereits im Fokus der Ermittlungen stehen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Polizei mehrere Richtlinien erarbeiten möchte, um sicherzustellen, dass keine Verhaftung ausschließlich aufgrund eines Gesichtserkennungsergebnisses erfolgen kann. Die Öffnung gegenüber dieser Technologie erfolgte erstmals öffentlich während eines Treffens der städtischen Feuerwehr- und Polizeikommission. Dort machte Polizeichefin von Milwaukee, Heather Hough, deutlich, dass man den sensiblen Spagat zwischen der Einführung neuer Technologien und dem Schutz der Bürgerrechte suche. Dennoch ist die Diskussion um die Einführung der Gesichtserkennung alles andere als abgeschlossen. Insbesondere Aktivisten, Bewohner und einige politische Vertreter äußerten sich kritisch und mahnten vor einer übermäßigen Überwachung der Bevölkerung.
Ihre Befürchtungen beziehen sich nicht nur auf die Privatsphäre von Stadtbewohnern, sondern auch auf den potenziellen Zugriff durch Bundesbehörden wie die Immigration and Customs Enforcement (ICE). Inzwischen haben einige amerikanische Städte wie Madison sogar ein Verbot der Nutzung von Gesichtserkennung durch städtische Behörden ausgesprochen. Aus Sicht der Befürworter ist die Gesichtserkennung ein mächtiges Werkzeug, das bei der Lösung schwerwiegender Straftaten einen Unterschied machen kann. Die Polizei präsentierte Beispiele, bei denen diese Technik zur Aufklärung von Mord- und Sexualdelikten beitrug. Dabei wurden Fotos von Tatverdächtigen mithilfe der Software abgeglichen, was zu ihrer Identifizierung führte.
Die Ergebnisse wurden anschließend durch weitere Ermittlungen bestätigt. Diese Praxis soll künftig durch den Zugang zu Biometrica-Technologie noch geordnet und effizienter umgesetzt werden. Biometrica, das Unternehmen hinter der angebotenen Software, hat seinen Ursprung im Bereich der Glücksspielindustrie in den späten 1990er Jahren. Laut den vorgelegten Informationen speichert das Unternehmen keine Fotos der Verdächtigen dauerhaft in seinen Systemen, sondern nutzt sie ausschließlich zum Abgleich mit der vorhandenen Datenbank. Gegen das initiale Angebot, die 2,5 Millionen Fotos zur Verfügung zu stellen, bietet Biometrica zwei kostenlose Suchlizenzen an.
Weitere Lizenzen würden pro Stück 12.000 US-Dollar kosten. Trotz dieser scheinbaren Vorteile bleibt die Skepsis groß. Kritiker bemängeln die mangelnde Transparenz und den möglichen Missbrauch der Technologie. Insbesondere werden systemische Vorurteile und die ungleiche Erkennung von Gesichtern von Personen mit dunkler Hautfarbe thematisiert.
Diese Probleme wurden bereits in zahlreichen Studien nachgewiesen. So berichtete der U.S. Commission on Civil Rights, dass Gesichtserkennungstechnologien ein erhöhtes Risiko darstellen, Menschen mit Farb- und Geschlechtsmerkmalen fehlerhaft zu identifizieren. Auch ein Mitglied der Feuerwehr- und Polizeikommission in Milwaukee, Ramon Evans, berichtete von eigenen negativen Erfahrungen mit Gesichtserkennung.
Er schilderte, wie er bei einem Casinobesuch fälschlicherweise aufgrund des Systems verdächtigt wurde. Solche Fälle verstärken das Misstrauen gegenüber der Technologie. Fachleute wie Thaddeus Johnson von der Georgia State University sehen dennoch differenzierte Anwendungsmöglichkeiten für Gesichtserkennung. Nach seiner Forschung kann die Technologie sinnvoll für schwerwiegende Verbrechen wie Mord eingesetzt werden, während sie bei weniger gravierenden Delikten wie Diebstahl tendenziell mehr Probleme mit Verzerrungen und Fehlidentifikationen verursachen kann. Die Qualität der Bilder und der richtige Kontext bei der Anwendung sind entscheidend für die Genauigkeit.
Neben den technischen und ethischen Herausforderungen wächst auch die Sorge, dass die zunehmende Überwachungstechnologie in Milwaukee bereits jetzt größere Ausmaße angenommen hat. Neben dem geplanten Einsatz der Gesichtserkennung hat die Polizei im vergangenen Monat die Einführung eines Drohnenteams bekanntgegeben. Diese Drohnen könnten künftig sogar mit der Gesichtserkennung verknüpft werden, obwohl eine aktuelle Dienstanweisung solche Verwendungen ausdrücklich untersagt. Weiterhin nutzt die Polizei Programme, bei denen Bürger durch Videoaufnahmen von Überwachungskameras Informationen an die Behörden weitergeben können. Ebenso gibt es in Milwaukee eine Vielzahl sogenannter FLOCK-Kameras, die automatisch Fahrzeugkennzeichen erfassen und so eine Überwachung des Straßenverkehrs ermöglichen.
Kritiker befürchten, dass diese Technologien zusammen eine beispiellose Überwachung und Kontrolle der Einwohner schaffen könnten. Die American Civil Liberties Union (ACLU) von Wisconsin fordert daher eine zweijährige Pause bei der Einführung neuer Überwachungstechnologien in Milwaukee. Sie drängt außerdem auf die Entwicklung umfassender Vorschriften und bindender Regelungen, bei deren Gestaltung die Bevölkerung eng eingebunden werden soll. Ein vorgeschlagenes Gremium namens „Citizen Control Over Police Surveillance“ (CCOPS) soll die Bürgerrechte schützen und eine bessere Kontrolle gewährleisten. Der Bürgermeister von Milwaukee, Cavalier Johnson, hat sich zu dem geplanten Vorgang bisher nicht öffentlich positioniert.
Die Debatte dürfte jedoch weiter an Fahrt aufnehmen, da sowohl die politischen Gremien als auch die Öffentlichkeit in den nächsten Monaten weitere Chancen zur Diskussion haben. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Debatte um den Tausch von 2,5 Millionen Haftfotos gegen die kostenlose Nutzung von Gesichtserkennungstechnologie für die Police in Milwaukee ein Spiegelbild der weltweiten Auseinandersetzung mit der Balance zwischen Sicherheit und Freiheit ist. Es geht um die Fragen, wie Technologie verantwortungsbewusst eingesetzt, wie Transparenz hergestellt und wie Bürgerrechte gewahrt werden können. Nur durch einen offenen und breit angelegten Dialog sowie klare Schutzmechanismen kann es gelingen, diese komplexe Herausforderung zu bewältigen und einen positiven Mehrwert für Gesellschaft und Sicherheit zu schaffen.