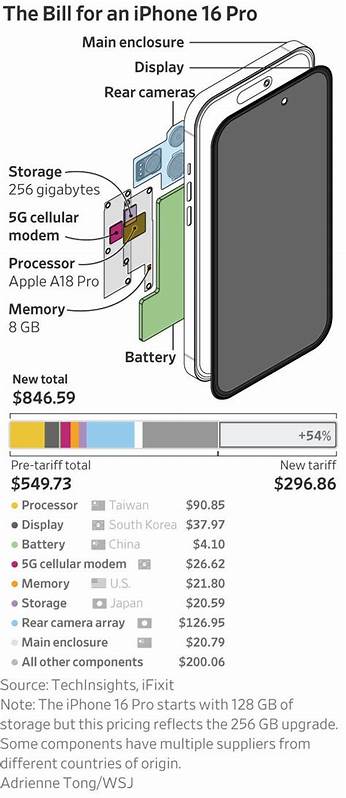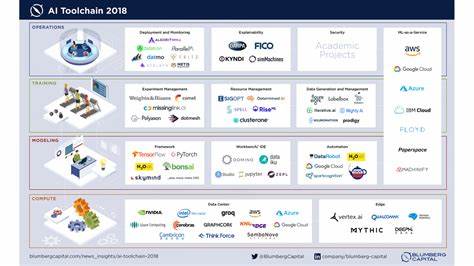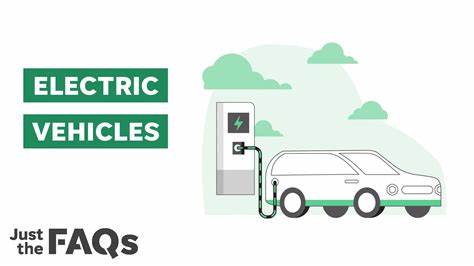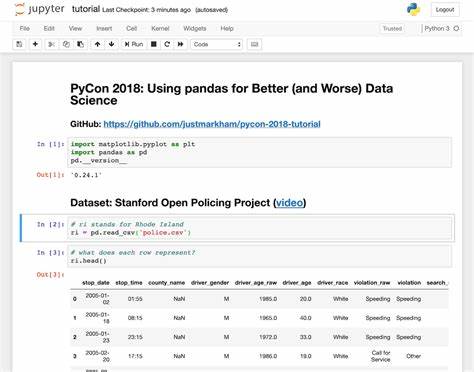Am 29. April 2025 erlebte Spanien einen massiven und beispiellosen Stromausfall, der die gesamte Iberische Halbinsel betraf. Das Ereignis, das sich am Mittag ereignete und bis in die frühen Morgenstunden des folgenden Tages andauerte, führte dazu, dass große Teile Spaniens und Portugals plötzlich ohne elektrischen Strom dastanden. Die Häufigkeit und das Ausmaß dieses Ausfalls sind bisher in der Region nahezu unvergleichlich und haben eine Debatte über die Sicherheit und Stabilität des Stromnetzes entfacht. Red Eléctrica de España, der Betreiber des spanischen Stromnetzes, hat auf einer Pressekonferenz alle Spekulationen um einen möglichen Cyberangriff als Ursache des Vorfalls kategorisch zurückgewiesen.
Eduardo Prieto, der Direktor für Betriebsdienste bei Red Eléctrica, betonte, dass keine Hinweise auf einen Angriff vorliegen und erste Ermittlungen auch Fehler durch menschliches Versagen ausschließen. Auch die spanische Wetterbehörde (Aemet) verneinte einen Einfluss extremer Wetterbedingungen. Trotzdem zeigt sich die spanische Regierung unter der Führung von Ministerpräsident Pedro Sánchez äußerst vorsichtig. Er kündigte zwei unabhängige Untersuchungen an, von denen eine vom Ministerium für Ökologischen Wandel betrieben wird und die andere auf europäischer Ebene durch die EU-Kommission begleitet wird. Diese Untersuchungen sollen Licht in die Ursachen des Stromausfalls bringen, insbesondere in Bezug auf die rätselhaften zwei kurz aufeinanderfolgenden Ereignisse, die zum Zusammenbruch des Netzes führten.
Sánchez ließ zudem offen, ob auch andere Ursachen wie Sabotage oder Fehler im System in Betracht gezogen werden. Der initiale Ausfall scheint laut Red Eléctrica zunächst eine plötzliche und erhebliche Verringerung der Stromproduktion im Südwesten Spaniens gewesen zu sein, möglicherweise aus photovoltischen Quellen. Der genaue Grund für den Ausfall in der Solarstromerzeugung wird derzeit noch erforscht. Die beiden Ereignisse, die den Zusammenbruch des Netzes ausgelöst haben, ereigneten sich nur Sekunden auseinander und führten schließlich zur automatischen Trennung der Verbindungen zwischen Spanien und Frankreich, wodurch das Festland energieautark wurde – jedoch in einem instabilen und letztlich zusammenbrechenden Zustand. Die Wiederherstellung des Stromnetzes gestaltete sich als äußerst komplex und dauerte mehrere Stunden.
Aufgrund der Komplexität eines vollständigen Neustarts eines Stromnetzes mussten zunächst Spannungsquellen entlang der Grenzen zu Frankreich und Marokko aktiviert werden. Von dort aus wurde die Versorgung schrittweise über Inselnetze in verschiedenen Regionen Spaniens wiederhergestellt. Diese „Inselverfahren“ waren notwendig, da nur bestimmte Kraftwerke, insbesondere Wasserkraftwerke, in der Lage sind, sich selbständig aus einem vollständigen Spannungsverlust heraus zu starten. Die Koordination und Synchronisation dieser Teilnetze in ein stabiles Gesamtnetz ist eine herausfordernde und zeitintensive Prozedur. Dieser Vorfall wirft Fragen zur Resilienz der Stromversorgung in Spanien auf.
Experten weisen darauf hin, dass der zunehmende Anteil erneuerbarer Energien wie Solar- und Windenergie zur Gesamtstromproduktion auch Herausforderungen mit sich bringt. Während konventionelle Kraftwerke mit großen rotierenden Generatoren eine natürliche Trägheit besitzen, die das Netz stabilisiert, fehlt diese inhärente Stabilität bei erneuerbaren Energiequellen. Derzeit wird geprüft, inwieweit die geringe „Trägheit“ des Systems zum Stromausfall beigetragen hat. Zudem ist die begrenzte Interkonnektivität Spaniens mit dem übrigen europäischen Stromnetz ein weiterer Aspekt, der zur Instabilität beigetragen haben könnte. Je stärker ein Stromnetz mit benachbarten Netzen verbunden ist, desto widerstandsfähiger ist es gegen lokale Störungen.
Die Trennung von Frankreich und die damit verbundene vollständige Isolierung Spaniens wurden als problematisch bewertet und könnten die Erholungsphase verlängert haben. Der Stromausfall fällt in einen sensiblen politischen Kontext. Spanien befindet sich in der Phase der geplanten Stilllegung der verbleibenden Atomkraftwerke, was von den oppositionellen Parteien stark kritisiert wird. Diese argumentieren, dass der zunehmende Anteil erneuerbarer Energien ohne entsprechende Backup-Kapazitäten die Versorgungssicherheit gefährden könnte. Ministerpräsident Sánchez wies diese Kritik jedoch zurück und sprach davon, dass weder die erneuerbaren Energien noch die Kernkraftanlagen allein für den Ausfall verantwortlich gemacht werden können.
Die juristischen Ermittlungen nehmen ebenfalls an Fahrt auf. Die spanische Nationalgerichtsbarkeit hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Möglichkeit eines absichtlichen digitalen Sabotageangriffs zu prüfen. Obwohl bislang keinerlei Beweise für einen solchen Angriff vorliegen, zeigt dieser Schritt, wie ernst die Behörden die Sicherheit kritischer Infrastrukturen nehmen. Die Stromversorger stehen nach dem Ereignis unter starkem Druck. Der spanische Staat hält eine Beteiligung an Red Eléctrica, stehen aber auch die privaten Betreiber der Erzeugungskapazitäten in der Kritik.
Minister Sánchez kündigte an, dass Verantwortung verlangt wird, sollten bei den Untersuchungen Fehler oder Versäumnisse aufgedeckt werden. Das Ereignis hat auch zu erheblichen Beeinträchtigungen im Alltag der Bürger geführt. Reisende blieben in Bahnhöfen wie der María-Zambrano-Station in Málaga über Nacht gestrandet. Öffentlichkeitsarbeit und Krisenmanagement wurden in den Tagen nach dem Ausfall intensiviert, um das Vertrauen in das Energiesystem wiederherzustellen. Langfristig stellt der Vorfall eine Herausforderung für die Energiepolitik und die zukünftige Ausgestaltung der Stromversorgung Spaniens dar.
Die Ergebnisse der unabhängigen Untersuchungen werden richtungsweisend sein für mögliche strukturelle Änderungen. Dabei wird es darum gehen, die Balance zwischen der Förderung erneuerbarer Energien, der Sicherstellung der Netzstabilität und der Verfügbarkeit von Reservekapazitäten zu finden. Auch die europäische Dimension gewinnt an Bedeutung. Der Auftrag an eine EU-geführte Untersuchung unterstreicht die Wichtigkeit grenzüberschreitender Zusammenarbeit und Harmonisierung der Energiesicherheitsstandards. Die Vernetzung der europäischen Stromnetze soll weiter gestärkt werden, um in Zukunft ähnliche großflächige Ausfälle besser verhindern zu können.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Stromausfall in Spanien am 29. April 2025 ein weiträumiges und komplexes Ereignis darstellt, dessen Ursachen noch nicht abschließend geklärt sind. Trotz der schnellen Reaktion von Red Eléctrica und anderen Akteuren zeigen sich systemische Schwachstellen, die es in Zukunft zu adressieren gilt. Die Kombination aus politischem Druck, technischer Herausforderung und wachsender Bedeutung erneuerbarer Energien macht die nächsten Monate und Jahre besonders spannend für die Energiebranche in Spanien und Europa insgesamt.