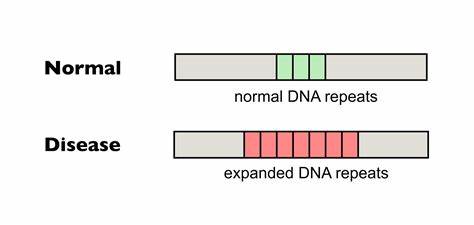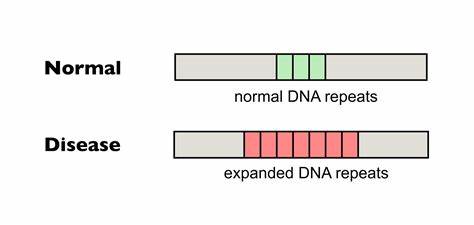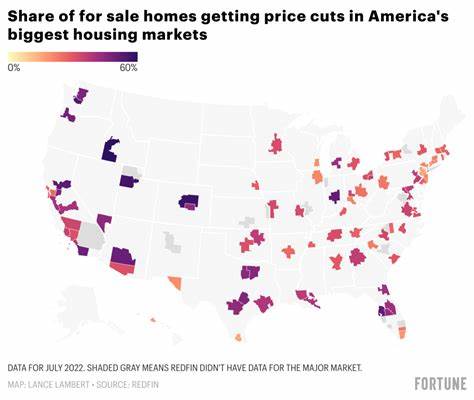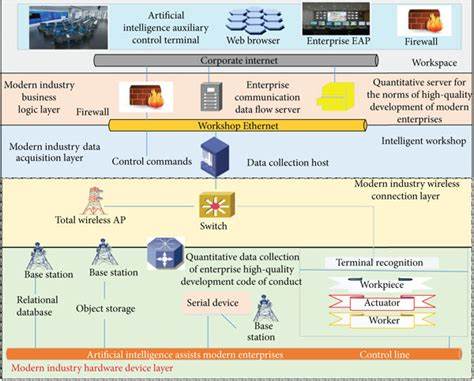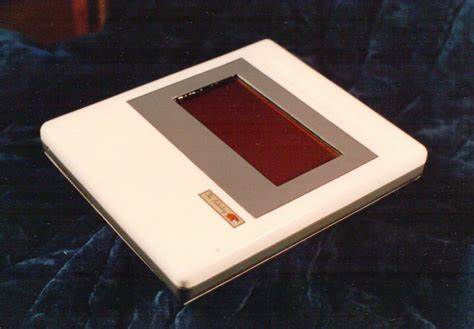Vor fast einem Jahrhundert hat der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten mit dem Urteil in der Rechtssache Humphrey's Executor ein Grundsatzurteil gefällt, das bis heute großen Einfluss auf die Struktur und Arbeitsweise der Bundesbehörden hat. Das Urteil, das 1935 erging, begründete die rechtliche Grundlage für die Unabhängigkeit bestimmter Verwaltungsbehörden gegenüber dem Präsidenten und etablierte Grenzen für dessen Macht bei der Abberufung von Amtsträgern in sogenannten „unabhängigen Agenturen“. Die Bedeutung von Humphrey's Executor zeigt sich nicht zuletzt an der aktuellen politischen Debatte. Nach mehreren Jahrzehnten, in denen dieses Urteil als unumstritten galt, wird es in der heutigen politischen Landschaft von konservativen Kreisen und der Trump-Administration erneut infrage gestellt. Dabei geht es um die grundlegende Frage, wie viel Macht die Exekutive im Verhältnis zu unabhängigen Behörden haben darf und wie weit die politische Einflussnahme durch die Präsidentenschaft reicht.
Dieser Artikel beleuchtet die Hintergründe, den historischen Kontext und die aktuellen Kontroversen rund um Humphrey's Executor und erklärt, warum ein fast 90 Jahre altes Urteil weiterhin enorme Relevanz besitzt. Die Entstehung von Humphrey's Executor ist eng verknüpft mit der Person William Humphrey, einem Republikaner aus Washington, der Mitglied der Federal Trade Commission (FTC) war. Die FTC ist eine von mehreren unabhängigen Bundesbehörden, die besondere Befugnisse zur Regulierung, zum Beispiel im Bereich Wettbewerb und Verbraucherschutz, innehaben und von mehrköpfigen Kommissionen geleitet werden. Als Präsident Franklin D. Roosevelt, ein Demokrat, kurz nach seinem Amtsantritt 1933 die Mitglieder der FTC neu besetzen wollte, forderte er Humphreys Rücktritt.
Humphrey weigerte sich jedoch, und FDR setzte ihn trotz gesetzlich eingeschränkter Entlassungsrechte ab. Laut damaligem Gesetz konnte ein Kommissar der FTC nur „aus Nachlässigkeit, Unfähigkeit oder Amtsmissbrauch“ entlassen werden, nicht aber aus politischen Gründen oder bloßer Präsidentenwillkür. Nach Humphreys Tod machte seine Nachlassverwalterin, der sogenannte „Executor“, die Rückzahlung seines Gehalts für die verweigerte Zeit geltend und zog vor Gericht. Der Supreme Court entschied einstimmig zu Gunsten von Humphreys Erben und stellte klar, dass bestimmte Ämter durch Gesetz vor willkürlicher Entlassung geschützt sind. Das bedeutete, der Präsident kann Leiter unabhängiger Behörden nicht einfach so abberufen, sondern benötigt einen triftigen Grund.
Diese Entscheidung legte die Grundlage für die junge Moderne des amerikanischen Verwaltungsstaates und etablierte die Idee, dass eine wirksame Trennung zwischen Exekutive und unabhängigen Behörden unverzichtbar ist. Das Urteil reflektiert auch den politischen Zeitgeist der frühen 1930er Jahre. In einer Phase, in der autoritäre Regime in Europa auf dem Vormarsch waren und die Frage nach der Machtverteilung im Staat neu diskutiert wurde, setzte der Supreme Court mit Humphrey's Executor ein Zeichen für die Bedeutung unabhängiger bürokratischer Strukturen in einer Demokratie. Es wurde damit verhindert, dass der Präsident unbegrenzte Kontrolle über sämtliche Bundesbehörden erlangt und diese als persönliche politische Werkzeuge missbraucht. Die wichtigsten Argumente, die für die Unabhängigkeit der Kommissionsmitglieder ins Feld geführt wurden, umfassen die Notwendigkeit, dass solche Behörden objektiv und ohne unmittelbaren politischen Druck handeln können.
Schließlich geht es oft um komplexe Regulierungen bei Themen wie Arbeitsrecht, Umweltschutz oder Wettbewerbsrecht, die langwierige, sachorientierte Entscheidungen erfordern. Wenn Kommissionsmitglieder hingegen von der jederzeitigen Willkür des Präsidenten abhängig wären, würde das den Aufbau nachhaltiger und stabiler Regelwerke erschweren, die das Vertrauen der Öffentlichkeit verdienen. In den Jahrzehnten nach Humphrey's Executor etablierten sich zahlreiche unabhängige Behörden, darunter die National Labor Relations Board (NLRB), die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und die Securities and Exchange Commission (SEC). Diese Agenturen wurden als quasi-autonome Bestandteile der Exekutive angesehen, die mit besonderen Schutzmechanismen ausgestattet sind, um ihren komplexen oder kontroversen Aufgaben gerecht zu werden. Parallel entwickelte sich die Debatte um die Verfassungskonformität solcher Schutzbestimmungen immer weiter, insbesondere da konservative Juristen immer wieder die Macht des Präsidenten stärken wollten.
Seit Beginn der 2010er Jahre beobachtet man bei der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs mit einer konservativen Mehrheit eine zunehmende Untergrabung des Schutzes unabhängiger Behörden. Unter Führung von Chief Justice John Roberts wurde die sogenannte „Removal Power“, also das Recht des Präsidenten, Amtsträger zu entlassen, wieder in den Vordergrund gerückt. In einem bedeutsamen Fall von 2020 bestätigte der Supreme Court, dass der Präsident das Recht hat, den Leiter eines Bundesamtes wie etwa des Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) zu entlassen – auch wenn dessen Statuten dies eigentlich nur unter engen Voraussetzungen erlauben. Dieses Urteil wurde als Einschränkung des Humphrey's Executor-Prinzips interpretiert, auch wenn das Urteil selbst die spezifische Struktur von Mehrpersonen-Kommissionen wie der FTC nicht direkt betraf. Einige Richter wie Clarence Thomas und Neil Gorsuch sprachen sich sogar dafür aus, das ganze Fundament des Humphrey’s Executor-Urteils gänzlich aufzuheben.
Für sie besteht kein verfassungsrechtlicher Grund für die Existenz unabhängiger Agenturen, die gegen den Willen des Präsidenten agieren. Dieses konservative Verständnis der Exekutivbefugnisse sieht vor, dass der Präsident letztlich uneingeschränkte Kontrolle über sämtliche Exekutivämter haben muss. Die Trump-Administration trat im Rahmen dieses juristischen und politischen Kontextes ebenfalls dafür ein, Humphrey’s Executor zu kippen. Nach dem Amtsantritt von Joe Biden im Januar 2025 und insbesondere im Licht der Entlassung von Gwynne Wilcox, dem ersten NLRB-Mitglied, das seit 1935 gefeuert wurde, stehen unabhängige Agenturen vor großen Herausforderungen. Wilcox klagt gegen ihre Entlassung und stellt somit die Rechtmäßigkeit der Kündigung und die Unabhängigkeit der Behörde juristisch infrage.
Die Stakeholder erkennen, wie weitreichend ein Sturz von Humphrey’s Executor für das amerikanische Regierungssystem wäre. Die möglichen Konsequenzen einer Aufhebung wären gravierend. Einrichtungen wie die FTC, die NLRB, aber auch die Federal Communications Commission (FCC) könnten zu direkten verlängerten Armen des Präsidenten werden, wodurch politische Einflussnahme noch direkter und unmittelbarer auf Regulierungen und Kontrollmechanismen Einfluss gewinnen würde. Viele Experten sehen darin eine Gefahr für die demokratische Kontrolle und die rechte Unabhängigkeit der Verwaltungsstaatlichkeit. Exemplarisch besonders interessant ist auch die Frage nach der Bundesbank Federal Reserve.
Die Fed genießt traditionell eine hohe Unabhängigkeit bei der Steuerung der Geldpolitik und der Zinsregulierung – Maßnahmen mit enormen wirtschaftlichen Auswirkungen. Obwohl die Trump-Administration bisher vorsichtig war, die Fed als Institution direkt anzugreifen, wäre ein Urteil, das Humphrey's Executor aufhebt, potentiell auch auf die Fed übertragbar. Damit könnten die Präsidenten vermehrt Einfluss auf die Geldpolitik nehmen, was viele Ökonomen skeptisch sehen. Gegner einer Aufhebung argumentieren, die Unabhängigkeit der Verwaltungsbehörden sei elementar für einen funktionierenden Rechtsstaat und für den Schutz der Bürgerinteressen vor politischer Willkür. Sie warnen davor, dass die Unterordnung aller Behörden unter die Exekutive zu einer übermäßigen Machtkonzentration führt, die im schlimmsten Fall zu autoritären Tendenzen führen kann.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Humphrey’s Executor weit mehr als nur ein altes Gerichtsurteil ist. Es steht für eine fundamentale Trennung von Macht innerhalb der US-Regierung und hat das amerikanische Regierungssystem nachhaltig beeinflusst. Während es in den kommenden Jahren wahrscheinlich weiter Gegenstand hitziger juristischer Auseinandersetzungen sein wird, bleibt seine Bedeutung als Schutzmechanismus gegen eine zu weitreichende Macht des Präsidenten von großer Tragweite. Die Debatte zeigt exemplarisch, wie verfassungsrechtliche Grundfragen stets neu ausgehandelt werden und wie sich historische Entscheidungen auch nach fast einem Jahrhundert noch im politischen Alltag auswirken.