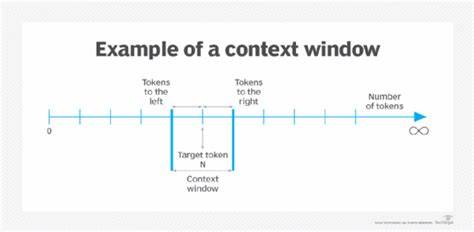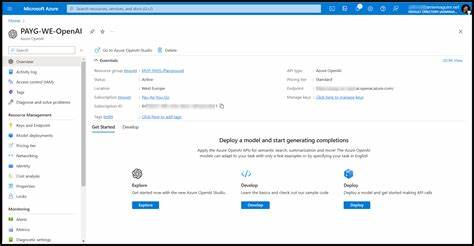Die University of Alabama at Birmingham (UAB) gerät aktuell in die Schlagzeilen, weil Professoren der Universität behaupten, Forschungsanträge würden durch die Verwaltung inhaltlich verändert oder eingeschränkt. Eine kürzlich kursierende Entwurf eines Briefes, den fast 200 Fakultätsmitglieder und Mitarbeiter unterzeichnet haben, macht darauf aufmerksam, dass administrative Stellen der Uni direkt in die Forschungsprozesse eingreifen, insbesondere wenn es um gesundheitliche Studienschwerpunkte auf Minderheiten geht. Diese Vorwürfe werfen eine Vielzahl von Fragen auf, die sowohl die akademische Freiheit als auch die Rolle von Hochschulen im gesellschaftlichen Diskurs berühren. Die Situation an der UAB steht zudem in einem größeren Kontext, in dem bundes- und landespolitische Vorgaben sowie gesellschaftliche Spannungen Einfluss auf wissenschaftliche Arbeit nehmen. In dem Brief, der mehreren Medien zugespielt wurde und auch mehreren Fakultätsmitgliedern zur Kenntnis gebracht wurde, wird darauf hingewiesen, dass Anwälte und Mitarbeitende der Universität aktiv Änderungen an Forschungsanträgen vornehmen.
Diese Änderungen sollen demnach wissenschaftliche und medizinische Zielsetzungen abschwächen oder verschleiern. Besonders problematisch ist demnach, dass Forschungsvorhaben, die sich auf die Gesundheit bestimmter rassischer und ethnischer Gruppen fokussieren, dadurch verwässert oder gar verhindert werden. Solche Eingriffe werden von den Fachmitgliedern als „Zensur“ empfunden. Die betroffenen Forschungsvorhaben adressieren wichtige gesundheitliche Fragen, die spezifische Bevölkerungsgruppen betreffen. Dazu gehören Studien zu Erbkrankheiten bei ethnischen Gruppen wie Ashkenazi-Juden, den niederländisch-amischen Gemeinschaften oder Westafrikanern sowie Forschung zur Müttersterblichkeit bei schwarzen Frauen.
Auch Untersuchungen zur Krankheitsübertragung bei sexuellen Minderheiten sind hiervon betroffen. Die Wissenschaftler kritisieren, dass der Ausschluss solcher Themen sowohl eine Verletzung ethischer Forschungsstandards als auch eine Einschränkung akademischer Freiheit darstellt. Die Anonymität und der Schutz der beteiligten Personen in den Studien sind dabei wichtige Bestandteil der Forschung, doch die Manipulation der Antragstexte untergräbt die wissenschaftliche Integrität und kann langfristige Folgen für gesellschaftliche Gesundheitsinitiativen haben. Die Maßnahmen der Universität stehen in enger Verbindung mit politischen Entwicklungen auf Bundes- und Bundesstaatsebene. Die Regierung unter Präsident Donald Trump hatte in der Vergangenheit öffentliche Briefe veröffentlicht, in denen sie sich kritisch gegenüber Diversitätsprogrammen an Universitäten äußerte und deren Finanzierung in Frage stellte.
Diese Initiativen setzten viele Universitäten unter Druck, ihre Forschungsschwerpunkte und Förderprogramme zu überdenken. Die UAB befindet sich hier nicht isoliert. So wurden an der Universität zum Beispiel kürzlich Stipendien für Minderheiten abgeschlossen und bereits erhaltene Spenden zum Teil an private Geber zurückgegeben. Dies signalisiert einen Wandel in der institutionellen Haltung zu bestimmten Forschungsthemen und Zielgruppen. Die universitäre Leitung hat sich bisher in Stellungnahmen eher zurückhaltend geäußert.
In einer Mitteilung erklärte ein Sprecher, die Universität sei bemüht, die Entwicklungen auf Landes- und Bundesebene zu beobachten und rechtliche Rahmenbedingungen einzuhalten. Gleichzeitig werde akademische Freiheit respektiert. Dieser Widerspruch zeigt die komplexe Lage auf, in der sich die Universität befindet: Einerseits gesetzliche und politische Vorgaben erfüllen, andererseits die wissenschaftliche Gründlichkeit und Freiheit bewahren. Das Problem der Einflussnahme auf Forschungsanträge ist allerdings kein rein lokales Phänomen. Es spiegelt eine breitere Debatte über die Rolle von Hochschulen und deren finanzielle Abhängigkeit von externen Fördermitteln wider.
Gerade bei sensiblen Themen wie Rassismus, Gesundheit von Minderheiten oder sozialen Ungleichheiten besteht die Gefahr, dass politische oder finanzielle Interessen die Forschungsagenda dominieren. Wissenschaftler und -wissenschaftlerinnen fordern daher eine transparente Richtlinie seitens der Universitätsleitung, die genau regelt, wie mit Forschungsanträgen umzugehen ist und wie sichergestellt wird, dass Forschung ohne Beschränkungen ihrer Inhalte durchgeführt werden kann. Die Folgen auf die akademische Gemeinschaft sind vielschichtig. Die Gefahr, dass bedeutende Forschungen zu gesellschaftlich relevanten Fragestellungen durch administrative Eingriffe verhindert werden, bedroht nicht nur die Reputation der UAB als Forschungseinrichtung, sondern wirkt sich auch negativ auf die betroffenen Bevölkerungsteile aus. Gerade solche Gruppen, deren Gesundheitsprobleme bereits unterrepräsentiert sind, würden durch eine wissenschaftliche Vernachlässigung weiter benachteiligt.
Die Debatte um akademische Freiheit erhält hier eine neue Dringlichkeit. Viele der involvierten Professoren und Forscher haben sich bislang nur zögerlich zu Wort gemeldet, wohl auch aus Sorge vor möglichen Repressalien. Die Anonymität der Unterzeichner in dem Brief spricht für eine Atmosphäre, in der Kritik am Verwaltungshandeln als riskant empfunden wird. Solche Verhältnisse können das Arbeitsklima an Hochschulen belasten und Nachwuchswissenschaftler abschrecken. Die Universität Alabama Birmingham steht damit exemplarisch für eine Herausforderung, vor der viele amerikanische Hochschulen heute stehen.