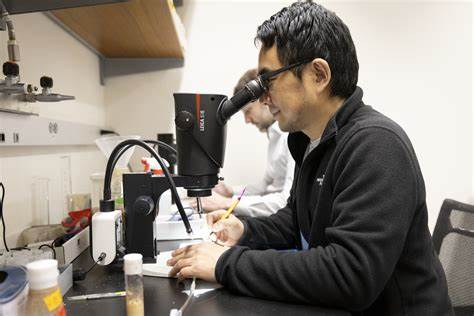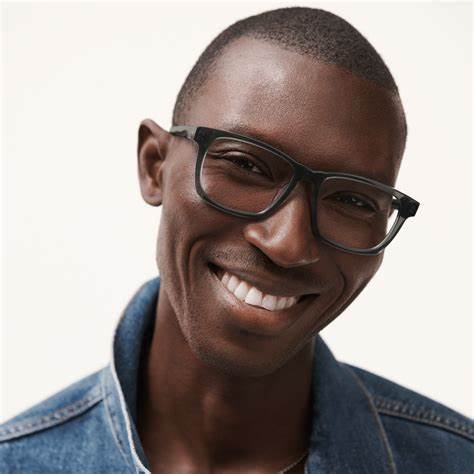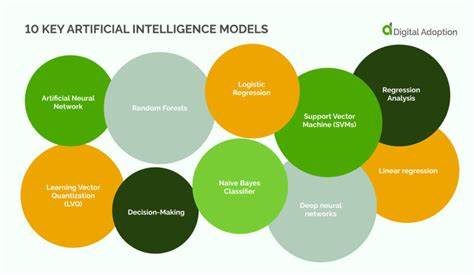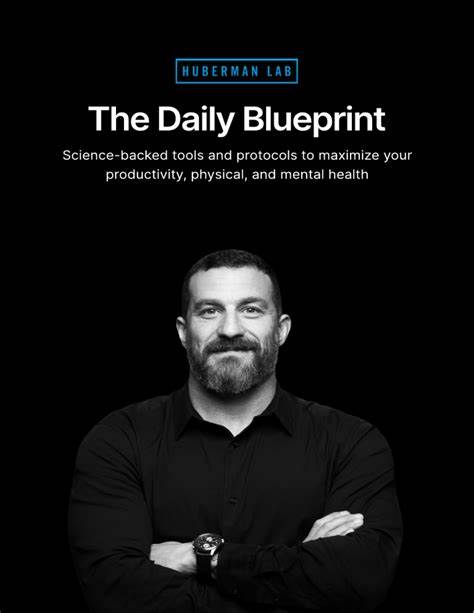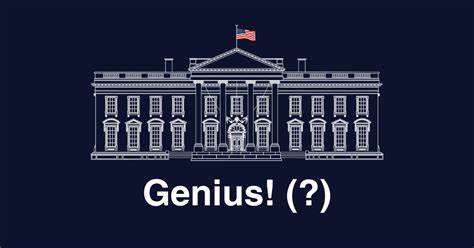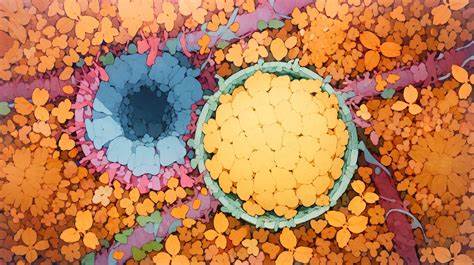Thomas Parr, oft unter dem ehrfurchtsvollen Namen „der alte, alte, sehr alte Mann“ bekannt, ist eine der faszinierendsten Figuren in der Geschichte der menschlichen Langlebigkeit. Er soll im Jahr 1483 geboren worden sein und erreichte Berichten zufolge das biblisch anmutende Alter von 152 Jahren. Seine wundersame Lebensgeschichte wurde im Herbst 1635 einem breiten Publikum vorgestellt, als er – bereits betagt und gesundheitlich angeschlagen – von seinem Rückzugsort in der ländlichen Grafschaft Shropshire ins damals moderne, hektische London gebracht wurde. Dort endete sein Leben abrupt, aber die Legende um ihn setzte sich für Jahrhunderte fort und prägte darüber hinaus sogar die Werbewelt der viktorianischen Epoche. Die Geschichte des alten Thomas Parr gibt einen einzigartigen Einblick in das Verhältnis von Gesellschaft, Medizin und Aberglauben über mehrere Jahrhunderte hinweg und überrascht mit einem Wechselspiel aus Glauben, Skepsis und Kommerz.
Im 17. Jahrhundert war London eine schnell wachsende Metropole und Anziehungspunkt für Menschen aus dem ganzen Land. Daher war die Ankunft eines Menschen, der angeblich über 150 Jahre alt war, an sich schon ein Ereignis von besonderem Interesse. Thomas Parr wurde auf Einladung des Earl of Arundel aus seinem Heimatdorf Winnington in Shropshire nach London gebracht. Der Earl war ein begeisterter Sammler antiker Gegenstände und sah in Parr eine lebendige Kuriosität.
Der Greis selbst war bis zu seinem hohen Alter als fleißiger Landwirt tätig und führte ein einfaches, ländliches Leben, das sich deutlich von den wohlhabenden und oft üppig lebenden Stadtbewohnern unterschied. Er heiratete erstmals erst im Alter von 80 Jahren, was ebenso bemerkenswert ist wie seine zweite Ehe im stolzen Alter von 122 Jahren. Sein Leben war nicht frei von sozialen Verfehlungen: So wurde berichtet, dass er mit über 100 Jahren einen öffentlichen Bußgang absolvierte, nachdem er einen Ehebruch begangen hatte – ein Beleg für die moralischen Vorstellungen und gesellschaftlichen Normen jener Zeit. Bei seiner Ankunft in der Hauptstadt wurde Parr sofort zum Gesprächsthema und erregte die Aufmerksamkeit der Königshäuser Charles I. und Königin Henrietta Maria.
Trotz seines hohen Alters war er noch zugänglich und zeigte Lebensfreude, lachte gerne und sprach herzhaft, wenn auch sein Körper Schwächen verriet – er war blind, hatte nur noch einen Zahn und war vom harten Leben gezeichnet. Innerhalb kurzer Zeit nach seiner Ankunft in London erkrankte Thomas Parr jedoch schwer und starb im November 1635. Seine Beisetzung in der Westminster Abbey unter einer schlichten Grabplatte, die seine lange Lebensspanne hervorhob, war Ausdruck des gesellschaftlichen Staunens und der Anerkennung für dieses vermeintliche Wunder der Natur. Aus heutiger Sicht überwiegt selbstverständlich die Skepsis gegenüber solchen Berichten von ungewöhnlicher Langlebigkeit. Berechtigte Zweifel wurden auch damals schon geäußert, so monierte der Historiker Thomas Fuller, dass viele alte Männer ihr Alter übertrieben angaben, um Aufmerksamkeit zu erlangen.
Dennoch war die Vorstellung, Menschen könnten weit über hundert Jahre alt werden, im 17. Jahrhundert durch den Einfluss biblischer Überlieferungen und den Glauben an übernatürliche Langlebigkeit tief verwurzelt. Geschichten von Figuren wie Katherine Fitzgerald oder Henry Jenkins verstärkten diese Überzeugung. Diese Mythen füllten die Lücken in der Dokumentation für gewöhnliche Menschen aus, da systematische Geburtsregister oder andere verlässliche Quellen für den Großteil der Bevölkerung fehlten. Die einzige offizielle Urkunde, die das Leben von Parr bestätigt, ist eine von 1588, die ihm und seiner Ehefrau ein lebenslanges Wohnrecht für eine Tenure in Shropshire gewährte.
Ansonsten basieren viele Erzählungen auf mündlichen Überlieferungen und poetischen Biographien, insbesondere der von John Taylor aus dem Jahr 1635. Im Mittelpunkt der zeitgenössischen Betrachtungen stand weniger die Frage nach der Echtheit seines Alters, sondern vielmehr die Suche nach Gründen für die enorme Lebensdauer und den plötzlichen Tod. Das Konzept der „sechs Nicht-Natürlichen“ Einflussgrößen (Luft und Umgebung, Ernährung, Bewegung, Schlaf, Ausscheidung und Emotionen) dominierte das medizinische Denken der frühen Neuzeit. Thomas Parr verkörperte das Ideal eines einfachen, naturnahen Lebensstils, der dem damaligen Stand der medizinischen Kunst zufolge gesundheitsfördernd war. Er lebte in frischer Landluft, ernährte sich bescheiden mit Brot, Käse und Zwiebeln, vermied starken Alkohol und Stress und schlief genügend.
Sein plötzlicher Tod in der Stadt wurde somit als Folge eines unnatürlichen Wechsels in seiner Lebensweise betrachtet: Die Umstellung auf ein reichhaltiges, schwer verdauliches Stadtessen sowie der Konsum von starkem Alkohol zermürbten seinen Körper, der an das „ehrliche Landleben“ gewöhnt war. Zudem machten ihn die damals weithin unbekannten gesundheitlichen Gefahren durch die Luftverschmutzung in London anfällig. Die dichte, belastete Atmosphäre voller Abfälle und stinkender Kanäle, verstärkt durch Rauch und Kohlefeuer, wurde als tödliche Belastung erkannt. Die Schriftsteller, Ärzte und Zeitgenossen sahen in Parrs Schicksal eine Mahnung und einen Beleg für die gesundheitlichen Gefahren der städtischen Moderne. Nach Parsons Tod trat seine Legende allerdings erst richtig ihren Siegeszug an.
Über die Jahrhunderte hinweg wurde seine Lebensgeschichte in Gedichten, Traktaten und sogar populären Theaterstücken weiterverbreitet. Er galt als Symbol für Durchhaltevermögen, Demut und ländliche Tugenden. Mehrere Jahrhunderte später wurde aus seiner Geschichte unerwartet ein lukratives Geschäft – die sogenannte „Longevity Trade“. Im 19. Jahrhundert nutzte der Nottinghamer Geschäftsmann Herbert Ingram die Bekanntheit von Thomas Parr, um ein neues Patentmedikament namens „Parr’s Life Pills“ zu vermarkten.
Dieses angebliche Heilmittel sollte das Geheimnis von Parrs Langlebigkeit enthalten und versprach, nahezu jedes Leiden zu heilen sowie das Leben zu verlängern. Die Pillen wurden ohne wissenschaftliche Belege oder medizinische Zulassung verkauft, was damals aufgrund fehlender Regulierung im boomenden Markt für Patentmedizin nur allzu einfach war. Die Vermarktung von Parr’s Life Pills war ein Kunststück aus geschicktem Storytelling und Massenwerbung. Die Kampagne basierte auf einer stark übertriebenen und teilweise gefälschten Biographie von Thomas Parr, nach der dieser die Rezeptur selbst entdeckt und geerbt habe. Die Pillen wurden weltweit verkauft, begleitet von unzähligen Testimonials, die Heilungen von Rheuma, Gicht und anderen Krankheiten schilderten.
Doch die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Zeitungen und Satiremagazine wie Punch machten sich über die unglaublichen Heilversprechen lustig, während Sozialkritiker wie Friedrich Engels die Gefährlichkeit solcher Präparate für schwer arbeitende Menschen anprangerten, die sich keine echte medizinische Betreuung leisten konnten und stattdessen auf dubiose Mittel hofften. Wissenschaftlich gründlich untersucht wurden die Pillen in angloamerikanischen Fachzeitschriften und durch Gesundheitsreformer immer wieder als „Quacksalberei“ gebrandmarkt. Die Belege für die Wirksamkeit waren allenfalls anekdotisch und beruhsten auf Suggestion und Erwartung. Der Historiker William J.
Thoms widerlegte in seinem Werk „Human Longevity“ 1873 viele Langlebigkeitsmythen, darunter auch den von Thomas Parr; er attestierte diesem eine bemerkenswerte, aber nicht außergewöhnliche Lebensspanne von rund 100 Jahren und bezeichnete die überlieferten Geschichten als „monströse Fabeln“. Infolgedessen schwand das öffentliche Interesse an den Pillen langsam, bis die Produktion Anfang des 20. Jahrhunderts eingestellt wurde. Das Vermächtnis von Thomas Parr ist bis heute ein eindrückliches Beispiel dafür, wie sich soziale Vorstellungen, medizinische Paradigmen und kommerzielle Interessen gegenseitig beeinflussen. Seine Geschichte zeigt, wie der Wunsch nach langer Gesundheit und ewigem Leben seit jeher menschliche Fantasie und Wissenschaft gleichermaßen beflügelt hat – und wie dabei oft Fakten und Fiktion verschwimmen.
Aus historischer Perspektive dient sein Leben als Spiegel für den Wandel im Umgang mit Alter, Krankheit und Heilversprechen – von frühneuzeitlichen Heilpraktiken bis zu moderner medizinischer Skepsis. Moderne Forscher und Historiker erinnern daran, dass trotz aller Fortschritte die Sehnsucht nach Langlebigkeit und Gesundheit nach wie vor ein Kino unzähliger neuer „Wundermittel“ und pseudowissenschaftlicher Produkte ist. Die Geschichte von Thomas Parr und seinen angeblichen Lebenspillen mahnt speziell in Zeiten zunehmender Kommerzialisierung von Gesundheitsprodukten zur Vorsicht gegenüber scheinbar spektakulären Versprechen. Zugleich liefert sie wertvolle Einblicke in die sozialen, kulturellen und gesundheitlichen Grundlagen des Alterns in der frühen Neuzeit. Abschließend bleibt die Erinnerung an den „Old, Old, Very Old Man“ als Mahnmal für den gesunden Menschenverstand und die Wissenschaft, die das Übernatürliche hinterfragt und sich dem ganzheitlichen Verständnis von Lebensführung und Altern verschreibt.
Die Legende von Thomas Parr verbindet somit nicht nur Vergangenheit und Gegenwart, sondern inspiriert zu einem bewussten Umgang mit der eigenen Gesundheit – frei von Illusionen, aber offen für gesunde Lebensweisen.