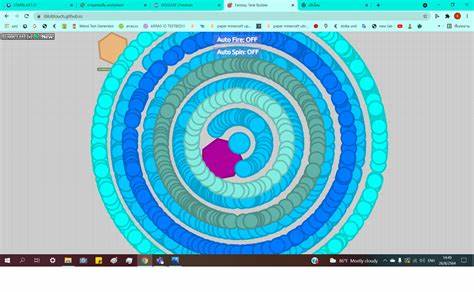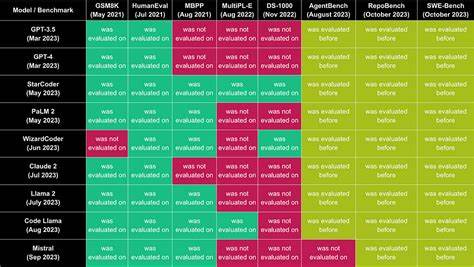In der heutigen schnelllebigen digitalen Welt spielt technische Dokumentation eine entscheidende Rolle, um komplexe Produkte und Software verständlich und zugänglich zu machen. Traditionell war die Erstellung von Dokumentationen oft getrennt von der Softwareentwicklung, was zu Kommunikationsproblemen, Verzögerungen und Qualitätseinbußen führen konnte. Hier setzt das Konzept „Docs like Code“ an, das die Dokumentation genau wie Softwareentwicklung behandelt. Doch was verbirgt sich genau hinter diesem Ansatz, warum gewinnt er immer mehr an Bedeutung und wie können Unternehmen und Einzelpersonen davon profitieren? „Docs like Code“ bedeutet im Kern, dass die Dokumentation mit denselben Methoden, Werkzeugen und Prozessen entwickelt, gepflegt und veröffentlicht wird wie der Programmcode selbst. Anstatt isoliert in spezialisierten, teils proprietären Tools zu arbeiten, nutzen Autoren und Entwickler offene Werkzeuge wie Versionskontrollsysteme, textbasierte Editoren und automatisierte Veröffentlichungsprozesse.
Dies schafft eine enge Verzahnung zwischen Produktentwicklung und Dokumentation mit zahlreichen Vorteilen. Einer der Hauptvorteile liegt in der verbesserten Zusammenarbeit. Indem Dokumentationsdateien im selben Repository wie der Quellcode liegen, können Entwicklungsteams gemeinsam an Inhalten arbeiten, Änderungen nachverfolgen und über Pull Requests und Reviews Feedback geben. Dadurch wird die Dokumentation dynamischer, aktueller und weniger fehleranfällig. Die Arbeitsschritte ähneln denen der Entwickler, sodass sie ihre gewohnten Werkzeuge einsetzen können, was wiederum die Akzeptanz fördert.
Technisch basiert „Docs like Code“ häufig auf textbasierten Formaten wie Markdown, AsciiDoc oder anderen leicht lesbaren und editierbaren Auszeichnungen. Markdown ist hierbei besonders beliebt, da es einfach zu erlernen und vielseitig einsetzbar ist. Die Textdateien werden mit Hilfe von static site generators (SSGs) wie MkDocs, Hugo oder Jekyll in moderne Websites, PDF-Dokumente oder andere Ausgabeformate konvertiert. Diese Generatoren erlauben eine klare Trennung zwischen Inhalt und Design, sind äußerst anpassbar und können mit Plugins erweitert werden. Damit der Entwicklungsprozess reibungslos abläuft, wird Versionskontrolle eingesetzt, meist über Git.
Git ist ein verteiltes Versionsverwaltungssystem, das es mehreren Personen ermöglicht, gleichzeitig an denselben Dateien zu arbeiten, Änderungen zu kollaborieren und Konflikte zu lösen. Die Nutzung von Plattformen wie GitHub, GitLab oder Bitbucket erleichtert zusätzlich das Management von Pull Requests, Issues und automatisierten Workflows. Ein weiterer Aspekt von „Docs like Code“ ist die Automatisierung des Build- und Deployment-Prozesses. Continuous Integration und Continuous Deployment (CI/CD) Pipelines ermöglichen es, dass jede Änderung an der Dokumentation automatisch gebaut, getestet und live gestellt wird. Dadurch reduziert sich der manuelle Aufwand und die Gefahr von Inkonsistenzen oder veralteten Inhalten wird minimiert.
Beliebte Hosting-Lösungen für statische Websites sind Cloudflare Pages, Netlify oder GitHub Pages, die speziell für solche Szenarien optimiert sind. Der Einstieg in „Docs like Code“ kann für Einsteiger durchaus herausfordernd sein. Die erforderlichen Kenntnisse in Git, Markdown und Build-Werkzeugen erfordern eine gewisse Lernkurve. Doch mit praxisorientiertem Lernen, Tutorials und Unterstützung aus der Community lassen sich diese Hürden überwinden. Es lohnt sich, Git zuerst gründlich kennenzulernen, da es die Grundlage bildet.
Danach kann man Schritt für Schritt die anderen Tools erleben und experimentieren. Im Vergleich zu traditionellen Dokumentationswerkzeugen wie MadCap Flare oder Knowledge-Base-Systemen sind die Tools für „Docs like Code“ in der Regel kostengünstiger oder sogar kostenlos zu haben. Viele Open-Source-Programme und frei verfügbare Themes reduzieren die Einstiegshürde und bieten gleichzeitig flexible Anpassungsmöglichkeiten. Allerdings erfordert die Einrichtung zu Beginn etwas technisches Know-how, insbesondere bei individuellen Anpassungen oder der Integration in bestehende IT-Infrastrukturen. Die Methodik von „Docs like Code“ fördert auch die Einbindung der Community.
Open-Source-Projekte beispielsweise genießen den Vorteil, dass jeder Nutzer direkt zu Dokumentationen beitragen kann – über Pull Requests können Korrekturen oder Erweiterungen vorgeschlagen werden. So wächst die Dokumentation gemeinsam mit dem Produkt und kann schneller auf Veränderungen reagieren. Zukunftsweisend ist außerdem, dass „Docs like Code“ die Dokumentation in den agilen Entwicklungsprozess integriert. Dokumentationsarbeit wird kein separater Schritt, der als Nacharbeit verstanden wird, sondern ein integraler Bestandteil jeder Produktiteration und Deployment-Phase. Dies führt zu einer höheren Qualität, da Dokumentationen zeitnah mitentwickelt und aktualisiert werden.
Für Unternehmen, die bereits Entwicklerteams beschäftigen und Softwareprodukte anbieten, bietet sich oft ein natürlicher Übergang zu „Docs like Code“ an. Die vorhandene Infrastruktur und das bestehende Know-how können genutzt werden, um Dokumentation effizienter und kollaborativer zu erstellen. So entstehen schlanke, moderne Dokumentationsprozesse, die Zeit sparen und die Nutzerzufriedenheit erhöhen. Wie sieht der typische Arbeitsablauf bei „Docs like Code“ aus? Dokumentationsautor oder Entwickler schreibt Inhalte in Markdown mit einem Texteditor wie Visual Studio Code. Anschließend wird der lokale Stand mit Git versioniert und Änderungen auf die zentrale Plattform wie GitHub gepusht.
Dort erfolgt eine Code- oder Dokureview und nach Freigabe wird die Änderung gemerged. Eine CI/CD-Pipeline erstellt automatisch den Website-Build und veröffentlicht die aktualisierten Inhalte. So ist die Dokumentation stets auf dem neuesten Stand und alle Beteiligten behalten die Übersicht. Die Notwendigkeit, den Umgang mit Git und anderen Tools zu erlernen, kann eine Hürde darstellen. Unterstützung bieten neben Dokumentationen und Tutorials vor allem die breite Entwickler-Community, Online-Kurse sowie vielfältige Workshops.
Zudem sorgen moderne grafische Oberflächen und Git-Clients für eine Schonung der Nerven und erleichtern den Einstieg. Die Nutzung von Linting-Tools für die Dokumentation sorgt zudem für eine höhere Qualität. Programme wie Vale prüfen Rechtschreibung, Stil und Konsistenz direkt während des Schreibens oder als Teil des automatisierten Workflows. Sie helfen, ein einheitliches Erscheinungsbild und eine klare Sprache zu gewährleisten, was besonders bei umfangreichen Dokumentationen wichtig ist. Insgesamt steht hinter „Docs like Code“ eine Bewegung, die Dokumentation als gleichwertigen Teil des Entwicklungsprozesses betrachtet, sie modular, leicht wartbar und kollaborativ gestaltet.
Dies passt hervorragend zu den Trends in der Softwareentwicklung, die agile Methoden, Open Source und Automatisierung bevorzugen. Für technische Redakteure und Autoren eröffnet dieses Konzept neue berufliche Perspektiven. Die Verbindung technischer Kompetenz mit Schreibfertigkeiten ist gefragt und ermöglicht eine stärkere Mitgestaltung am Produkt. Gleichzeitig sind gute Kommunikationsfähigkeiten essenziell, um mit Entwicklerteams effektiv zusammenzuarbeiten und komplexe Sachverhalte verständlich aufzubereiten. Die Praxis zeigt, dass Unternehmen, die „Docs like Code“ etablieren, weniger Fehler in der Dokumentation haben und die Aktualität sowie Verfügbarkeit von Informationen deutlich verbessert wird.
Dies trägt maßgeblich zur Kundenzufriedenheit, zur Verringerung von Support-Anfragen und zu einem positiven Produktimage bei. Abschließend lässt sich sagen, dass „Docs like Code“ ein moderner Ansatz ist, der technische Dokumentation fit für die digitale Gegenwart und Zukunft macht. Die Investition in das Erlernen der nötigen Werkzeuge und Abläufe zahlt sich langfristig durch effizientere Arbeitsweisen und bessere Resultate aus. Wer heute seine Dokumentation nicht nur als Anhang, sondern als integralen Bestandteil eines agilen Teams betrachtet, ist auf dem besten Weg, nachhaltigen Erfolg zu sichern.
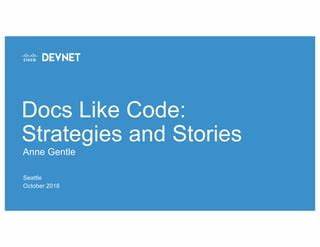



![Your coffee shop doesn't use two-phase commit (2005) [pdf]](/images/9B039C64-F912-4FDE-9636-8103D00FEEBC)