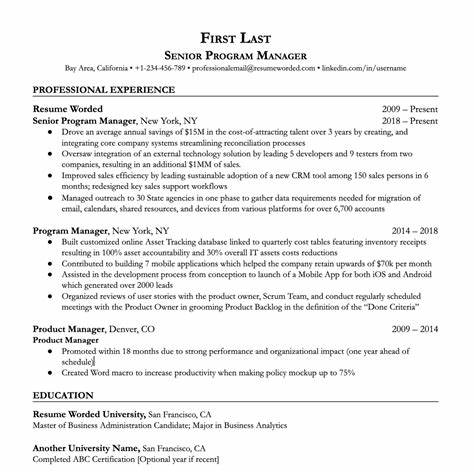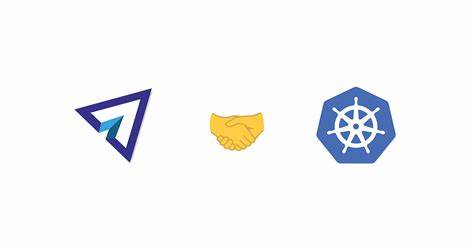Die Kaffeehauskultur hat sich im Laufe der Jahrhunderte stetig gewandelt. War das Café einst ein Ort der Begegnung, des Austauschs und der Entspannung, so sind mit dem digitalen Zeitalter neue Nutzungsformen hinzugekommen. Besonders seit der Corona-Pandemie und dem massiven Anstieg der Remote-Arbeit haben sich zahlreiche Menschen angewöhnt, ihr Home Office in öffentliche Cafés zu verlegen. Während dies zunächst als willkommene Entwicklung galt, sehen sich viele Betreiber heute mit unerwarteten Herausforderungen konfrontiert und reagieren mit weitreichenden Maßnahmen: WLAN-Abschaltungen, Einschränkungen bei der Laptop-Nutzung und neue Hausregeln. Diese Veränderungen stehen symptomatisch für eine tiefgreifende Transformation des Kaffeehauses und werfen Fragen zur Zukunft dieser beliebten Orte auf.
In den vergangenen Jahren wurde das Café vielfach als „dritter Raum“ bezeichnet, eine Zwischenwelt zwischen Zuhause und Arbeitsplatz. Gerade für remote arbeitende Menschen bot sich das Kaffeehaus als perfekte Alternative zum Heimarbeitsplatz an. Viele von ihnen nutzen den Ort, um Videokonferenzen abzuhalten, an Projekten zu arbeiten oder einfach konzentriert zu sein. Doch diese Entwicklung hat ihre Schattenseiten. Einige Cafés berichten davon, dass einzelne Personen über Stunden hinweg denselben Platz blockieren, den andere Kunden nutzen möchten.
Die Folge sind Überfüllung, eine erhöhte Belastung der Infrastruktur und eine veränderte Atmosphäre, die viele Betreiber und Stammkunden als negativ bewerten. Allein das Thema WLAN-Nutzung spielt dabei eine zentrale Rolle. Viele Cafés haben ursprünglich kostenloses WLAN als Service angeboten, um Kunden anzuziehen und zu binden. Doch wird der Internetzugang heute oftmals exzessiv genutzt – vor allem von Menschen, die lange Arbeitstage oder ganze Meetings im Café verbringen. Einige Betreiber sehen darin ein Geschäftsrisiko, da so die Kundenfrequenz für Kurzbesuche und traditionelle Cafégäste sinkt.
Überdies entsteht ein Ungleichgewicht, das sich auf Umsätze und Gästestruktur auswirkt. Vor diesem Hintergrund haben zahlreiche Cafés in Deutschland und anderen Ländern begonnen, ihre WLAN-Politik grundlegend zu überdenken. Einige verzichten komplett auf öffentliches Internet, um „Zoom-Squatters“ – also Personen, die ihre Online-Meetings auf Kosten anderer führen – fernzuhalten. Andere führen zeitliche Beschränkungen ein oder erheben Zugangscodes, die den Internetzugang regulieren. Einige knüpfen die Nutzung an Mindestumsätze oder limitieren die Dauer auf ein bis zwei Stunden.
Ein anderes Mittel zur Steuerung der Nutzung ist der Verzicht auf Steckdosen und Ladestationen, die gerade von mobilen Arbeitenden umfangreich genutzt werden. Einige Cafés haben sogar die Stromanschlüsse mit Klebeband abgeklebt, um das Wochenendverweilen und das Arbeiten mit Laptops zu unterbinden. Diese Maßnahmen sollen die Verweildauer begrenzen und mehr Platz für andere Gäste schaffen. Die Beweggründe der Betreiber sind dabei vielfältig. Neben wirtschaftlichen Erwägungen steht häufig auch das Anliegen im Vordergrund, den sozialen Charakter des Cafés zu erhalten.
Viele Unternehmer möchten eine Atmosphäre schaffen, in der Begegnungen zwischen Menschen möglich sind – nicht nur digital via Bildschirm, sondern im direkten Gespräch. Das Treffen ohne Ablenkungen durch Arbeit und Bildschirme fördert die Kommunikation und erfüllt das Café mit neuer Lebendigkeit. Ein Beispiel dafür ist die New Yorker Kaffeehauskette Devoción, die ihr WLAN zeitlich begrenzt und komplett an Wochenenden abschaltet. Hier soll die Balance zwischen Remote-Arbeitern und klassischen Cafébesuchern gewahrt bleiben – eine Strategie, die inzwischen auch in deutschen Städten diskutiert wird. Aber nicht alle Reaktionen auf diese Situation sind strikt ablehnend.
Einige Cafés bieten alternative Arbeitsformate an, die den Bedürfnissen mobiler Arbeitenden gerecht werden, ohne die gesamte Kundschaft zu benachteiligen. In Berlin experimentieren etwa einige Lokale mit speziellen Coworking-Zeiten oder vermieten Tagespässe für das Arbeiten am Laptop inklusive Nutzung moderner Technik. Diese hybride Form berücksichtigt sowohl den Wunsch nach konzentrierter Arbeit als auch den Anspruch auf Begegnungen und Wertschöpfung durch klassische Cafébesuche. Doch wie reagieren die Kunden auf diese Veränderungen? Die Entfernung von WLAN und das Verbot von Arbeitsgeräten stoßen nicht selten auf Unverständnis, vor allem bei jenen, die den öffentlichen Raum gezielt für ihre Produktivität nutzen. Gleichzeitig finden viele Menschen diese Maßnahmen auch bereichernd.
Sie schätzen die Möglichkeit, wieder ungestört und offline eine Auszeit zu nehmen, eine gute Tasse Kaffee zu genießen und echte soziale Kontakte zu pflegen. Die Debatte spiegelt dabei eine grundsätzliche Frage wider: Wie soll der öffentliche Raum in einer zunehmend digitalen Welt gestaltet sein? Sind Cafés nur Orte des kurzen Aufenthalts und der Geselligkeit oder entfalten sie auch eine wichtige Funktion als flexibel nutzbare Arbeitsplätze? Die Realität spricht für ein Nebeneinander verschiedener Nutzungsmodelle und den Bedarf an differenzierten Angeboten, die den verschiedenen Zielgruppen gerecht werden. Neben wirtschaftlichen und atmosphärischen Überlegungen gibt es noch einen weiteren wichtigen Aspekt: den Einfluss auf die Nachbarschaft und das Gemeinwesen. Wenn Cafés durch lange Sitzungen von Remote-Arbeitern überfüllt sind und klassische Kunden keinen Platz finden, liegt der Gemeinschaftsgedanke auf der Strecke. Die oft günstigen und offenen Treffpunkte drohen so ihre öffentliche Funktion zu verlieren.



![I Visited a Chinese NAS Factory and Here Is What I Saw [video]](/images/233BF9C6-E7C9-4221-888E-FF4FC4547BEC)