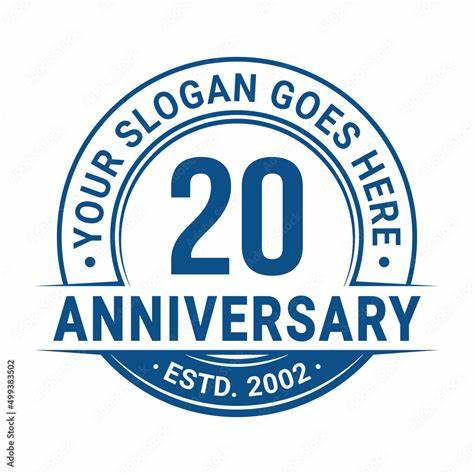Die Klimakrise ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit und betrifft weltweit sämtliche Gesellschaftsschichten. Doch während die globale Erwärmung und ihre Folgen als ein gemeinsames Problem verstanden werden, sind die Auswirkungen keineswegs gleich verteilt. Besonders Frauen und Mädchen tragen eine unverhältnismäßig schwere Last, was eine Verschärfung der ohnehin bestehenden Geschlechterungleichheiten bedeutet. Die Verbindung von Umweltkrise und sozialen Ungerechtigkeiten offenbart sich in vielen Facetten und Regionen der Welt und wirft ein Schlaglicht auf das dringende Erfordernis geschlechtsspezifischer Antworten im Klimaschutz. Die Klimakrise fungiert als sogenannter „Threat Multiplier“, ein Bedrohungsverstärker, der bestehende Ungleichheiten nicht nur untermauert, sondern verschärft.
Frauen und Mädchen sind vielfach von struktureller Diskriminierung betroffen, die durch klimabedingte Katastrophen und Veränderungen zusätzlich verschlimmert wird. Dabei sind es vor allem Frauen in ärmeren und verwundbaren Ländern, die an vorderster Front der Klimafolgen kämpfen – sei es in Bezug auf Ernährungssicherheit, Bildung, Gesundheit oder soziale Sicherheit. Ein markantes Beispiel für diese Dynamik zeigt sich in Nigeria, einem Land, das von steigenden Temperaturen, Dürreperioden und immer häufiger auftretenden extremen Wetterereignissen wie Überschwemmungen und Erdrutschen betroffen ist. Besonders Mädchen und junge Frauen sehen sich hier mit multiplen Herausforderungen konfrontiert. Der Zugang zu Bildung wird häufig durch klimatische Bedingungen erschwert: Schulen werden durch Überflutungen unzugänglich oder unsicher, und in belasteten Haushalten müssen Kinder im Alltag helfen oder Geld verdienen, wodurch Mädchen besonders häufig von der Schule ausgeschlossen werden.
Studien zeigen, dass jedes zusätzliche Jahr Schulbildung bei Mädchen die Resilienz einer Gesellschaft gegenüber klimatischen Katastrophen messbar verbessert – ein Umstand, der die Bedeutung von Bildung als Schlüssel zu Klimaanpassung und sozialer Gleichstellung unterstreicht. Organisationen wie das Center for Girls’ Education in der nördlichen Stadt Zaria setzen darüber hinaus wichtige Impulse, indem sie nicht nur die Schulbildung fördern, sondern Mädchen auch über die Folgen des Klimawandels aufklären und sie befähigen, mit den Herausforderungen – wie etwa Produktionsausfällen oder wetterbedingten Beschränkungen – besser umzugehen. So lernen die Mädchen beispielsweise Anpassungsstrategien für Landwirtschaft oder alternative Einkommensquellen. Dennoch bleibt der Weg steinig, denn oft sind kulturelle Barrieren, gesundheitliche Einschränkungen und Sicherheitsrisiken, etwa auf dem Schulweg, zusätzliche Hindernisse. Auch in Südamerika, konkret im Nordosten Brasiliens, zeichnet sich ein Bild der Benachteiligung ab, das eng mit der Klimakrise verwoben ist.
Die Frauen in der Amazonas-Region sind stark von der Abholzung und der Zerstörung der Wälder betroffen, die nicht nur den ökologischen Gleichgewichtspunkt des Amazonas gefährden, sondern auch die Existenzgrundlagen vieler indigener und ländlicher Gemeinschaften unterminieren. Für viele dieser Frauen ist das Sammeln von Babassu-Kokosnüssen eine der grundlegenden Einkommensquellen. Doch der Vormarsch großer landwirtschaftlicher Konzerne nimmt den Frauen zunehmend den Zugang zu ihren traditionellen Ressourcen, was Hunger und Armut verschlimmert. In Reaktion auf diese Bedrohungen haben sich mehr als 2.000 Frauen in der Babassu Coconut Breakers Movement zusammengeschlossen, um ihren Zugang zu den Wäldern zu verteidigen und nachhaltige Nutzungskonzepte zu fördern.
Dieses Engagement ist nicht nur ein Kampf um wirtschaftliche Selbstbestimmung, sondern auch ein Beitrag zur Erhaltung des Waldes als essenziellen Kohlenstoffspeicher, der für die globale Klimastabilität unverzichtbar ist. Die Frauen werden damit zu wichtigen Akteurinnen im Umweltschutz und in der sozialen Gleichstellung. Gleichzeitig ist in Asien, besonders auf den Philippinen, der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Geschlechterungleichheit besonders gravierend, wenn es um das Thema Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung geht. Naturkatastrophen wie Taifun Haiyan mit ihren Massenvertreibungen und den damit einhergehenden chaotischen Lebensbedingungen begünstigen die Anfälligkeit von Frauen und Mädchen für sexuellen Missbrauch und Zwangsprostitution. Das Fehlen sicherer Aufenthaltsorte, wirtschaftliche Not und das Auseinandergerissenwerden von Familien verschlechtern die Schutzmechanismen erheblich.
Organisationen wie die PREDA Foundation kämpfen aktiv gegen diese Entwicklung, indem sie Überlebenden von Menschenhandel Zuflucht bieten und Präventionsarbeit leisten. Die Prognosen der Wissenschaft zeigen zudem, dass die Intensität und Häufigkeit von Wirbelstürmen bis 2050 erheblich zunehmen werden, was das Risiko steigert und die Dringlichkeit verdeutlicht, diese Problematik nicht nur als gesellschaftliches, sondern auch als klimapolitisches Thema zu verstehen. In Pakistan begegnet die Klimakrise vor allem Schwangeren mit besonderen Gefahren. Die extremen Hitzeperioden im Bundesstaat Sindh, die Temperaturen weit über 50 Grad Celsius erreichen können, führen bei werdenden Müttern zu ernstzunehmenden Komplikationen wie Frühgeburten, Fehlgeburten und niedrigem Geburtsgewicht. Die wirtschaftliche Situation zwingt viele Frauen trotz extremer Belastungen dazu, Draußen oder in schlecht belüfteten Räumen zu arbeiten, was die gesundheitlichen Risiken weiter erhöht.
Neben der direkten Gesundheitsgefährdung zählen auch die unzureichenden finanziellen Mittel und mangelhafte Infrastruktur zu den Faktoren, die Frauen in dieser Situation besonders verletzlich machen. Forderungen nach besserer Versorgung, etwa durch Zugang zu Solarenergie zur Kühlung, sowie gezielte Unterstützungsprojekte werden immer dringlicher, um Mütter und Babys zu schützen. In Lateinamerika, exemplarisch in Guatemala, zeigt sich die Klimakrise als Treiber von Migration und sozialer Verwundbarkeit. Die Änderungen der regenintensiven Jahreszeiten führen zu Ernteeinbußen und erhöhter Armut. Während überwiegend Männer in andere Länder migrieren, bleiben Frauen zurück und übernehmen sowohl die Verantwortung für die Familieneinnahmen als auch die Pflege der Kinder.
Dies führt zu einer doppelten Last, die Bildungschancen und wirtschaftliche Selbstständigkeit der Frauen stark beeinträchtigt. Verschiedene Programme unterstützen Frauen in diesen abgelegenen Regionen durch Bildung, Führungskräftetraining und landwirtschaftliche Weiterbildung. Die Verbesserung der Rolle von Frauen in der Landwirtschaft könnte global gesehen die Produktion erheblich steigern und so den Hunger reduzieren. Damit zeigen sich auch wirtschaftliche Anreize für eine gerechtere Verteilung der Ressourcen und Entwicklungschancen. Ein weiteres alarmierendes Beispiel liefert Bangladesch, ein Land, das von steigenden Fluten und häufigen Zyklonen betroffen ist.
Die Folgen sind enge Verknüpfungen zwischen extremen Wetterereignissen und der Zunahme von Kinderehen. Familien, die durch wiederkehrende Naturkatastrophen in finanzielle Not geraten, sehen in frühen Ehen einerseits eine vermeintliche Entlastung. Andererseits tragen Mädchen dadurch die Last von Schwangerschaften und familiärer Verantwortung in sehr jungem Alter und verlieren häufig den Zugang zu Bildung und persönlicher Entwicklung. Organisationen wie Save the Children warnen vor steigendem Risiko und fordern verstärkte Maßnahmen, um Kinderehen zu verhindern und Mädchen in ihrem Recht auf Bildung und Schutz zu stärken. Die Klimakrise wird so nicht nur zu einer Umwelt- und Menschenrechtskrise, sondern zu einem zentralen sozialen Thema.
Auch in Afrika, am Beispiel Kenias, zeigt sich, wie klimabedingte Dürren und Überschwemmungen die Gewalt gegen Frauen verstärken. Die wirtschaftliche Belastung durch Ernteausfälle und Wasserknappheit erhöht den Stress in Familien, was zu einem Anstieg häuslicher Gewalt führt. Frauen, die weite Wege zurücklegen müssen, um Wasser oder Nahrungsmittel zu beschaffen, setzen sich weitaus höheren Risiken von Übergriffen aus. Hilfsorganisationen und zivilgesellschaftliche Gruppen versuchen, diesen Teufelskreis durch Sensibilisierung, politische Lobbyarbeit und die Bereitstellung von Hilfs- und Schutzstrukturen zu durchbrechen. Auch in diesem Kontext wird klar, dass Klimaschutz eng mit Gendergerechtigkeit verbunden ist und nicht losgelöst voneinander betrachtet werden darf.
Die vielfältigen Beispiele aus Nigeria, Brasilien, den Philippinen, Pakistan, Guatemala, Bangladesch und Kenia zeigen eindrucksvoll, dass die Klimakrise nicht nur eine Frage des Umweltschutzes ist. Sie ist zutiefst verwoben mit sozialen Strukturen, Machtverhältnissen und historisch gewachsenen Ungleichheiten. Frauen sind oftmals als erste betroffen und zugleich Motorinnen für Anpassung und Wandel. Daher bedarf es einer integrativen und geschlechtersensiblen Klimapolitik, die Frauen nicht nur als Opfer, sondern als entscheidende Akteurinnen wahrnimmt. Investitionen in Bildung, Schutz vor Gewalt, Gesundheitsversorgung und ökonomische Unabhängigkeit sind Grundpfeiler, um den Kreislauf von Ungleichheit und Klimafolgen zu durchbrechen.
Die internationale Gemeinschaft, Regierungen, NGOs und die Gesellschaft insgesamt müssen gemeinsam daran arbeiten, Klimagerechtigkeit mit Geschlechtergerechtigkeit zu verbinden, um eine nachhaltige und gerechte Zukunft zu gestalten. Die geradezu existenzielle Bedrohung durch die Erderwärmung zeigt sich in den Existenzen und Geschichten von Frauen auf der ganzen Welt. Ihr Einsatz und ihre Widerstandsfähigkeit sind beispielhaft für den menschlichen Überlebenswillen, doch wirkliche Veränderungen erfordern systematischen Wandel – hin zu mehr Gleichberechtigung, sozialer Sicherheit und einem verantwortungsvollen Umgang mit unserem Planeten.



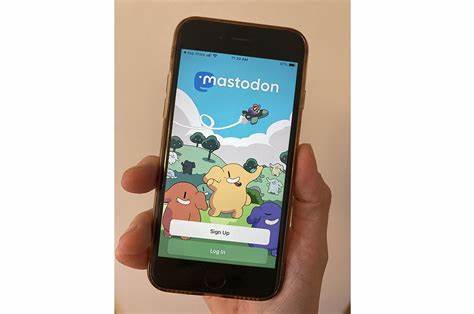


![New computers don't speed up old code [video]](/images/9CFB9055-4ED3-42CA-B8DC-D10F7B7A6E8B)