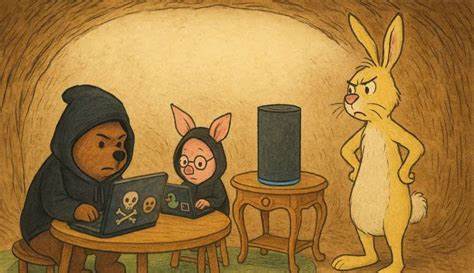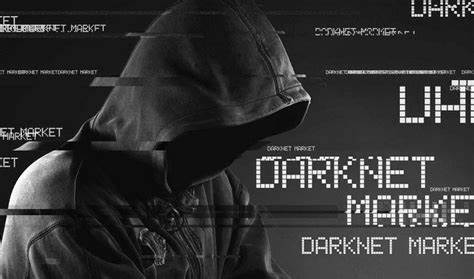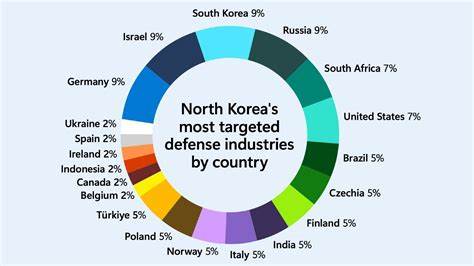Die Yandex Station ist ein intelligenter Lautsprecher, der im russischen Markt als innovatives Gerät für die smarte Heimsteuerung gilt. Neben der Nutzung im Alltag erweckt das System aufgrund seiner Komplexität und proprietären Bauweise großes Interesse in der Reverse-Engineering-Community. Im Zentrum steht die Debug-Konsole, welche über UART zugänglich ist und den tiefen Einblick in den Startvorgang und die Firmware ermöglicht. Dieses Forschungsfeld gleicht metaphorisch einer Erkundung in einem „Hasenbau“, da das Eindringen in die Systemtiefen sehr herausfordernd und voller Überraschungen ist. Am Anfang der Untersuchung steht der Bootloader U-Boot, ein weit verbreiteter und modularer Bootloader in der Embedded-Welt.
Bei der Yandex Station ist U-Boot im Bootprozess als Komponente BL33 eingebettet und durch verschiedene Sicherheitsmechanismen geschützt. Der Bootloader startet das Gerät, initiiert die Hardware und lädt das Hauptbetriebssystem. Seine Sicherung und Verschlüsselung verhindern unbefugten Zugriff auf die darunter liegende Firmware. Allerdings existiert eine Schwachstelle, die es ermöglicht, den verschlüsselten Bootloader über den USB-Port im DFU-Modus zu extrahieren. Der Zugang zur Debug-Konsole erfolgt meist über die UART-Schnittstelle.
Auf den ersten Blick fällt die Meldung "RH challenge" und "RH response" auf, welche Teil des sogenannten Rabbit Hole-Authentifizierungsmechanismus sind. Im Gegensatz zu standardisierten Autorisierungsmethoden wie SHA256-Hash-basierten Passwörtern hat Yandex hier eine eigene Variante entwickelt. Diese fordert bei der Eingabe in die U-Boot-Konsole eine dynamische Antwort, was einen zusätzlichen Schutz gegen unbefugten Zugriff darstellt. Die Herstellung der Firmware-Extraktion erfordert zunächst das Beschaffen des Firmware-Abbildes aus dem Gerät. Typischerweise erfolgt dies mit einem dedizierten Programmer oder Tools, die speziell für Amlogic-Chips entwickelt wurden, wie das USB-Update-Tool, das in der Amlogic-Dokumentation dokumentiert ist.
Die Yandex Station-Varianten Lite, Mini2 und Max basieren auf SoCs wie Amlogic S905X2 und A113X. Diese Plattformen verwenden unterschiedliche Speichertechnologien – Lite und Mini2 nutzen NAND-Speicher, bei Max kommt eMMC zum Einsatz. Daraus resultieren unterschiedliche Partitionierungsstrategien und Bootloader-Strukturen. Der Bootloader selbst ist in mehreren Stufen aufgebaut. BL1 ist fix im SoC verbaut und nicht veränderbar, während BL2 die weitere Initialisierung übernimmt.
BL31 und BL32 sind für Sicherheitsfunktionen zuständig, während BL33 den eigentlichen U-Boot-Bootloader darstellt. Bei der Yandex Station ist die verschlüsselte Firmware durch diese mehrstufige Architektur vor Eingriffen geschützt. Ein wichtiger Schlüssel bei der Analyse ist die Identifikation des BL33-Abschnitts. Dieser kann an der Signatur @AML erkannt werden, die in den Binärdateien mehrfach erscheint. Die letzte Signatur markiert in der Regel den U-Boot-Bereich.
Interessant ist außerdem, dass die U-Boot-Komponente mit LZ4-Kompression kodiert ist, was auf effiziente Speicherbenutzung hindeutet, gleichzeitig aber das direkte Auslesen erschwert. LZ4 ist ein extrem schneller Komprimierungsalgorithmus, der häufig in Embedded-Systemen verwendet wird. Das direkte Entpacken der Firmware gestaltet sich schwierig. Erste Versuche mit herkömmlichen Archivierern schlagen fehl, da die Header-Daten beschädigt oder verschlüsselt sind. Hier hilft nur eine gründliche Analyse der Binärdaten und der Aufbau von spezifischen Tools.
Die standardmäßige LZ4-Entpackung erfordert explizit Informationen über die Ursprungslänge der Daten vor der Kompression, welche nicht einsehbar hinter einer Verschlüsselung verborgen ist. In der Analyse kam das Open-Source-Tool Diaphora zum Einsatz, das IDA Pro ergänzt und bei der Gegenüberstellung von Binärdateien unterstützt. Mit Diaphora können Ähnlichkeiten zwischen der extrahierten Firmware und bekannten Open-Source-Projekten gefunden werden, was eine Art Gütesiegel für die Korrektheit der Analyse darstellt. Zusätzlich wurde FindCrypt genutzt, ein Plugin, das nach Crypto-Constants sucht und kryptografische Bestandteile in Binärdateien identifiziert. Diese Werkzeuge kombinieren technische Tiefe mit Effizienz und eröffnen neue Möglichkeiten für Reverse Engineering.
Ein besonderer Fokus liegt auf der Nutzung der bekannten Schwachstelle, die es erlaubt, Bootloader-Dateien unverschlüsselt über den USB-Port auszulesen, sofern kein Passwort gesetzt ist. Zum Zeitpunkt der Analyse waren viele Yandex-Geräte noch ungesichert, da Yandex erst nach und nach beginnt, Firmware-Passwörter remote zu setzen. Diese Zeitspanne ermöglicht einen tieferen Einblick in die Systemarchitektur und die Sicherheitsarchitektur der Yandex Station. Die extrahierte Firmware kann anschließend mit den geeigneten Tools manuell entschlüsselt und dekomprimiert werden, wodurch die Analyse auf Quellcodeebene möglich wird. Dabei zeigt sich, wie die einzelnen Bootloader-Phasen ineinandergreifen, welche Funktionen sie abbilden und wie die Sicherheitsprüfungen gestaltet sind.
Auch werden eigene Modifikationen des U-Boot-Systems durch Yandex sichtbar. Das Verständnis dieser Prozesse ist nicht nur aus technischer Neugier interessant, sondern eröffnet auch Perspektiven hinsichtlich der Sicherheit von IoT-Geräten. Aufgrund der immer weiter fortschreitenden Vernetzung von Haushaltsgeräten spielt die Integrität des Bootvorgangs eine entscheidende Rolle, um Manipulationen und unerwünschte Eingriffe zu verhindern. Für jene, die in die Thematik tiefer einsteigen wollen, empfiehlt sich der Zugang zur Community-Plattform „Xakep.ru“, wo vertiefte Informationen und weitere Materialien bereitgestellt werden.
Dort finden sich auch Diskussionen rund um Firmware, Hardware-Reverse-Engineering und Sicherheitslücken, die speziell IoT- und Embedded-Geräte betreffen. Abschließend zeigt die Untersuchung der Debug-Konsole der Yandex Station, wie komplex und vielschichtig moderne IoT-Geräte sind. Der Bootloader und dessen Sicherheitsmechanismen sind ein Spiegelbild technologischer Fortschritte und zugleich Angriffsziel für Hacker und Sicherheitsforscher. Die Kombination aus Reverse-Engineering-Tools, gezieltem Firmware-Extrahieren und der Analyse moderner Komprimierungs- und Verschlüsselungsverfahren liefert wertvolle Erkenntnisse, die sowohl Entwicklern als auch Sicherheitsverantwortlichen helfen können, ihre Produkte besser abzusichern und potenzielle Schwachstellen frühzeitig zu erkennen.