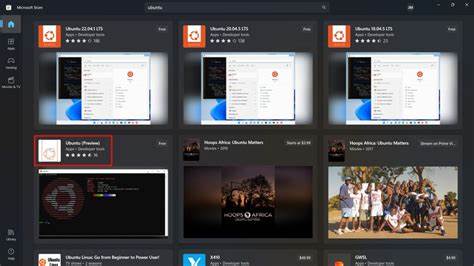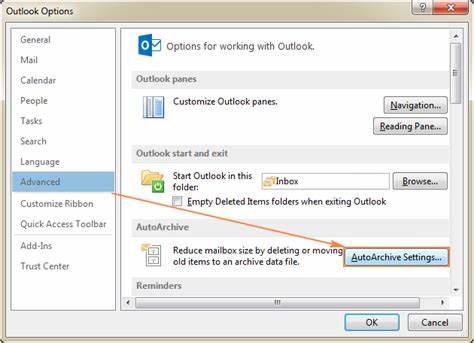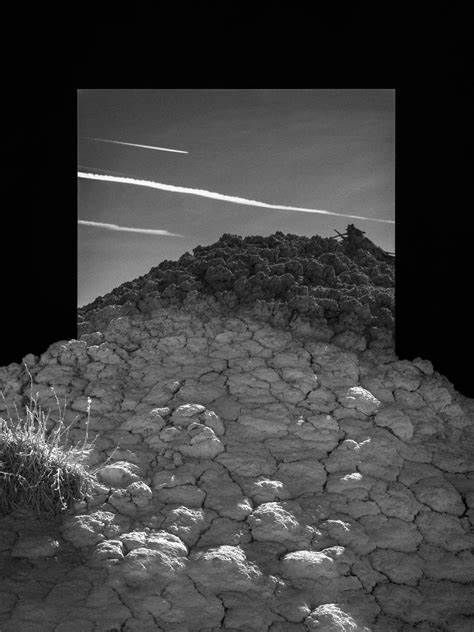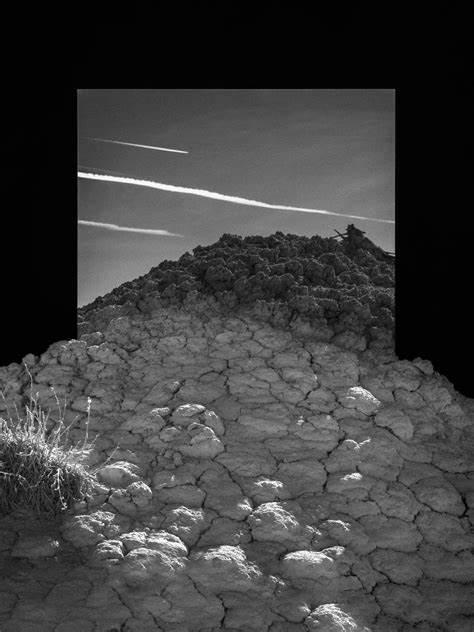Nathan Fielders Serie „The Rehearsal“ hat mit ihrer zweiten Staffel neue Maßstäbe gesetzt und die Erwartungen an das Medium Fernsehen und Performancekunst weit überschritten. Während die erste Staffel das Potenzial des Reenactments von alltäglichen sozialen Situationen auslotete, geht die Fortsetzung noch einen Schritt weiter und führt das Konzept von Realitätssimulation auf eine noch bizarrere und dabei äußerst sinnvolle Ebene. Das fulminante Finale dieser Staffel ist dabei nicht nur eine logische Zuspitzung der bisherigen Experimente, sondern auch ein zutiefst philosophischer Kommentar über Authentizität, zwischenmenschlichen Kontakt und die Grenzen der menschlichen Erfahrung. Im Zentrum der Serie steht Nathan Fielder selbst, dessen Ansatz Performancekunst und Alltag miteinander verwebt. Wie bereits in der ersten Staffel, in der er seinen Teilnehmern durch detaillierte Nachstellungen echter Umgebungen half, soziale Situationen vorwegzunehmen und dadurch ihre Angst vor unausweichlicher sozialer Verwirrung zu mildern, verschiebt Fielder auch hier erneut die Grenzen zwischen Kunst und Wirklichkeit.
Die Besonderheit des Formats liegt in der kompromisslosen Liebe zum Detail: Fielder rekonstruiert ganze Bars, Wohnungen oder Arbeitsplatzsituationen, um seinen Probanden einen geschützten Raum zu bieten – einen „Sandkasten“ –, in dem sie Interaktionen proben und anschließend leichter im echten Leben bewältigen können. Die zweite Staffel verstärkt diesen Ansatz auf spektakuläre Weise, indem Fleder ganze Lebensabschnitte von Menschen nachstellt – bis hin zur Entwicklung eines Kindes vom Säugling bis zum Teenager. Die Tragweite dieser Ambition zeigt sich auch darin, dass Fielder selbst zunehmend zum Versuchskaninchen wird. Seine eigene Unfähigkeit, gesellschaftliche Kommunikation mühelos zu meistern, wird zum Subjekt einer experimentellen Selbstuntersuchung. Dabei zeigt sich eine faszinierende Koinzidenz: Obwohl er von Schauspielern umgeben ist, deren Aufgabe es ist, Emotionen glaubwürdig darzustellen, geht es bei den Übungen längst nicht mehr darum, innere Gefühle zu erspüren, sondern vielmehr Verhaltensweisen zu erlernen, zu imitieren und zu verfeinern.
Die Serie stellt damit das Konzept der Eigentlichkeit infrage und rückt die performative Dimension sozialen Handelns in den Vordergrund. Besonders prägnant wird diese Idee in der Pilotfolge der zweiten Staffel, die sich dem Thema Flugsicherung widmet. Es sind reale Cockpit-Dispute und -Desaster, die hier Ausgangspunkt für dramatisch nachgestellte Szenarien bilden. Fielder überträgt das Grundprinzip seines Formats in den Hochrisikobereich der Luftfahrt und untersucht dort den Einfluss offener Kommunikation und gegenseitiger Kritik auf die Sicherheit. Diese fesselnde Kombination aus dokumentarischem Ernst und humoristischer Überzeichnung zeigt exemplarisch, wie „The Rehearsal“ als Performance auch gesellschaftliche Relevanz entfalten kann.
Die minutiöse Nachbildung eines Flughafen-Terminals und die Beschäftigung von knapp hundert Schauspielern ermöglichen es, authentische Kommunikationssituationen in einem kontrollierten Setting zu simulieren. Flugzeugbesatzungen werden eingeladen, die im echten Leben häufig unter der Last von Hierarchien und Unsicherheiten leiden, die Rollen des offenen und ehrlichen Austausches probezuspielen. Hierdurch entsteht eine Art spielerisches Labor, dessen Erkenntnisse über das soziale Miteinander auch über die Luftfahrt hinaus Gültigkeit beanspruchen. Trotz der intensiven Recherche und akribischen Planung entfällt die Serie nie in trockene Didaktik. Stattdessen entfaltet sich eine komplexe Darstellung der menschlichen Psyche, die Einblicke gewährt in Ängste, Zwänge und Strategien, wie Menschen mit zwischenmenschlicher Unsicherheit umgehen.
Dabei berührt „The Rehearsal“ philosophische Konzepte der Identität, wie sie Jean-Paul Sartre in seinem Werk „Das Sein und das Nichts“ thematisierte, und vergleicht den starre, festgelegten „Kellner“ mit dem freien, spielerischen „Schauspieler“. Diese Reflexionen bilden den Rahmen für die Erkundung von Schauspiel als Medium, das nicht nur Imitation ist, sondern ein Instrument zur Bewältigung des sozialen Daseins. Nathan Fielders Anliegen geht jedoch über klassische Schauspieltheorie weit hinaus. Er distanziert sich bewusst von der Method-Acting-Tradition, die das Erleben authentischer innerer Gefühle anstrebt, und verfolgt stattdessen eine pragmatische, fast schon kalkulierte Herangehensweise, die Schauspiel als das Erlernen von notwendigen Verhaltensweisen begriff. Dieses Verständnis schlägt sich auch in seinem Konzept der „Fielder Method“ nieder, einer Technik, bei der der Fokus auf der Überzeugungskraft der Darstellung gegenüber anderen liegt – echtes Fühlen wird dabei als überflüssig entlarvt.
Der dramatische Höhepunkt und gleichzeitig emotional aufwühlende Abschluss der zweiten Staffel ist die Folge „My Controls“. Hier wagt Fielder ein waghalsiges Experiment, das sein bisheriges Konzept von Simulation auf eine neue Dimension hebt. Er wird selbst Pilot einer Boeing 737 – mit einer Gruppe von echten Schauspielern als Passagiere – und verwandelt damit seine abstrahierte Welt der Übung in eine gefährliche Realität. Seine Flugausbildung, die er meist nur in einem Flugsimulator absolviert hat, endet mit einem realen Flug über die Wüste Kaliforniens, bei dem seine Fähigkeiten auf eine harte Probe gestellt werden. Diese Episode sprengt nicht nur die vorherigen Grenzen der Serie, sondern stellt eine sich selbst superponierende Reflexion über Risiko, Authentizität und Kontrollverlust dar.
Fielders Selbstinszenierung als Pilot, der trotz limitierter Qualifikationen die Verantwortung für eine Passagiergruppe übernimmt, ist gleichermaßen absurd wie faszinierend. Gleichzeitig zeigt sich durch diese Überhöhung der Serie, dass das Schauspiel als Werkzeug zum Meistern der alltäglichen Wirklichkeit einen radikalen Schritt macht – an die Schwelle zum Unmöglichen. „The Rehearsal“ legt damit das Paradox der menschlichen Existenz offen: Unsere sozialen Rollen sind keine festen Identitäten, sondern flexibel und künstlich, doch in deren Inszenierung liegt eine mächtige Kraft, die es erlaubt, Unsicherheiten zu mildern und Beziehungen zu gestalten. Die Serie setzt sich mit dem Wunsch auseinander, menschliche Verhaltensweisen zu verstehen, zu erlernen und sicher zu navigieren, auch wenn der eigene Zugang zu Gefühlen und spontaner Interaktion mangelhaft erscheint. Neben der künstlerischen Brillanz besitzt „The Rehearsal“ auch einen gesellschaftlichen Wert.