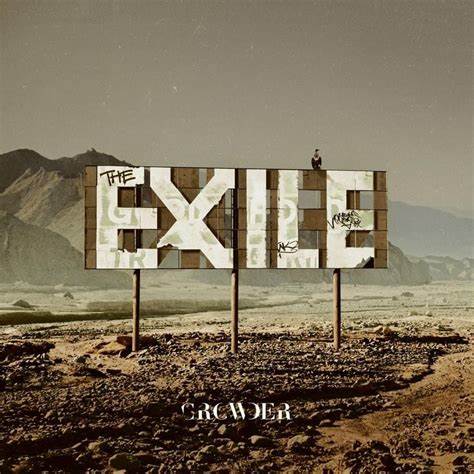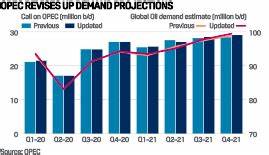Die Erforschung des Universums stellt die Wissenschaft seit Jahrhunderten vor komplexe Rätsel. Eines der größten ungelösten Probleme ist die Dunkle Materie – eine mysteriöse Form von Materie, die zwar etwa 85 Prozent der Masse im Universum ausmacht, aber weder direkt sichtbar noch greifbar ist. Die Annahme ihrer Existenz basiert hauptsächlich auf der Beobachtung der Rotationskurven von Galaxien. Diese zeigen, dass sich Sterne und Gas in Galaxien mit Geschwindigkeiten bewegen, die nach den klassischen Newtonschen Gravitationsgesetzen eigentlich nicht möglich wären, ohne dass zusätzlich unsichtbare Masse existiert. Während viele astrophysikalische Modelle bislang die Dunkle Materie als notwendige Erklärung für diese Diskrepanz angesehen haben, gibt es inzwischen eine alternative Theorie, die mit einer grundlegenden Erweiterung der Gravitationstheorie arbeitet: der Gravitomagnetismus.
Der Gravitomagnetismus basiert auf einer speziellen Eigenschaft der Allgemeinen Relativitätstheorie, der von Albert Einstein entwickelten Erweiterung der klassischen Gravitationstheorie Newtons. Während sich die Newtonsche Gravitation lediglich auf statische Massen und deren Newtonsches Gravitationsfeld bezieht, berücksichtigt die Allgemeine Relativitätstheorie zusätzliche dynamische Effekte, die durch Bewegungen von Massen entstehen. Einer dieser Effekte ist das sogenannte Frame-Dragging oder auch Lense-Thirring-Effekt. Dabei zieht ein rotierender massereicher Körper wie ein Stern oder ein Schwarzes Loch die Raumzeit mit sich und bewirkt dadurch ein gravitomagnetisches Feld, das analog zu magnetischen Feldern in der Elektrodynamik wirkt. Die konventionellen Berechnungen der Galaxienrotation basieren zumeist auf einfachen Newtonschen Modellen, die diese gravitomagnetischen Effekte nicht mit einbeziehen.
Dies hat zur Folge, dass die beobachteten Rotationsgeschwindigkeiten von Sternen und Gaswolken in den äußeren Bereichen der Galaxien nicht durch die allein sichtbare baryonische Materie erklärt werden können. Daraus wurde die Existenz der Dunklen Materie abgeleitet. Doch Forscher wie Gerson Otto Ludwig vom Nationalen Institut für Raumfahrtforschung in Brasilien stellen diese Annahme nun infrage. In einer im Jahr 2021 veröffentlichten Studie schlägt Ludwig vor, die gravitomagnetischen Effekte in die Modelle zur Erklärung von Galaxienrotationen einzubeziehen. Seine Berechnungen zeigen, dass diese Effekte, zwar relativ schwach, dennoch eine signifikante Rolle spielen und den gravitativen Einfluss zusätzlicher, unsichtbarer Materie weitgehend ersetzen können.
Damit könnte der scheinbare „Fehlbetrag“ an Masse in Galaxien nicht mehr als Hinweis auf Dunkle Materie gedeutet werden, sondern als eine Konsequenz unzureichender Modellierungen der Gravitation. Die Bedeutung dieses Ansatzes darf nicht unterschätzt werden, denn die Dunkle Materie ist eine der fundamentalen Hypothesen moderner Kosmologie und Astrophysik. Sie beeinflusst das Verständnis von Strukturentstehung, Galaxienbildung und sogar die Entwicklung des Universums im Großen und Ganzen. Eine Beweisführung, die zeigt, dass gravitomagnetische Effekte ausreichen, um die Rotation von Galaxien zu erklären, könnte die Grundlagen vieler etablierter Modelle nachhaltig verändern. Doch es gibt auch Herausforderungen.
Die Berechnung von gravitomagnetischen Effekten in großräumigen, komplexen Systemen wie Galaxien ist äußerst kompliziert. Diese Systeme sind dynamisch, entwickeln sich im Zeitverlauf und sind meist nicht symmetrisch. Das macht eine realitätsnahe Modellierung anspruchsvoll und rechenintensiv. Ludwig weist darauf hin, dass die Zeitentwicklung von Galaxien innerhalb dieses Rahmenwerks noch tiefgründiger analysiert werden muss, um die vollständigen Konsequenzen zu verstehen und ein breites wissenschaftliches Konsens zu ermöglichen. Trotz der noch offenen Fragen bietet der gravitomagnetische Ansatz viele Vorteile.
Er benötigt keine neuen, bislang unbekannten Teilchen oder Materieformen, die bisher nicht direkt nachgewiesen wurden – was für einige Wissenschaftler einen wichtigen Aspekt darstellt, da die Teilchensuche von Dunkler Materie lange Zeit erfolglos blieb. Ebenso vermeidet das Modell die Einführung zusätzlicher freier Parameter, die die bisherigen Theorien oft flexibler machen, aber auch schwerer überprüfbar. Darüber hinaus könnte dieser neue Ansatz auch Auswirkungen auf andere astrophysikalische Phänomene haben, bei denen Unstimmigkeiten zwischen Theorie und Beobachtung bestehen. Beispielsweise könnten Effekte wie das Verhalten von galaktischen Jets, die Verteilung von Materie in Kugelsternhaufen oder sogar Eigenschaften von sogenannten gravitativ gebundenen Systemen neu betrachtet werden. Während der Gravitomagnetismus also theoretisch vielversprechend erscheint, wird die breite wissenschaftliche Anerkennung noch durch weitere empirische Untersuchungen, komplexe Simulationen und Vergleiche mit anderen alternativen Erklärungen und Beobachtungen gefordert.
Dazu zählen unter anderem auch alternative Gravitationstheorien wie Modified Newtonian Dynamics (MOND) oder andere Erweiterungen der Allgemeinen Relativitätstheorie. Wichtig ist auch der Aspekt der Skalierbarkeit des Modells – kann die Berücksichtigung von Gravitomagnetismus nicht nur auf Einzelsysteme angewandt werden, sondern auch auf größere Skalen wie Galaxienhaufen oder sogar das gesamte Universum? Die Dynamik auf diesen Skalen ist ebenfalls durch Beobachtungen geprägt, die normalerweise Dunkle Materie als Erklärung benötigen. Sollten sich die gravitomagnetischen Modelle als tragfähig herausstellen, könnten viele kosmologische Theorien einer grundlegenden Überarbeitung bedürfen. Die Diskussion um die Dunkle Materie ist ein Paradebeispiel für den wissenschaftlichen Prozess: Ein Phänomen wird beobachtet, Hypothesen werden gebildet und dann im Laufe der Zeit verfeinert oder durch neue Erkenntnisse ersetzt. Die Einbeziehung von Gravitomagnetismus könnte ein bedeutender Schritt in dieser Entwicklung sein, der das Verständnis des Universums vertieft und gleichzeitig dazu beiträgt, das immer noch rätselhafte Wesen der Schwerkraft besser zu verstehen.