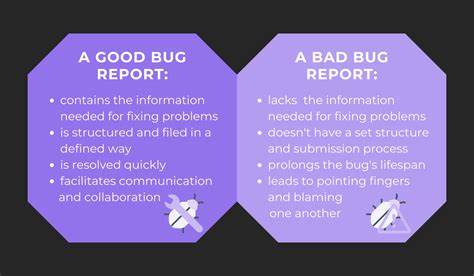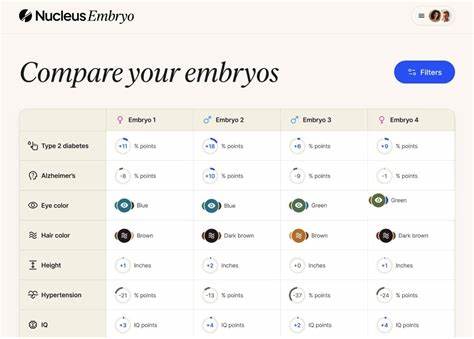Die Hochsee, jene internationalen Gewässer, die sich außerhalb der nationalen Hoheitsgebiete befinden, bedecken beeindruckende 61 Prozent der Ozeanfläche und erstrecken sich über fast 43 Prozent der Erdoberfläche. Diese gigantische Meeresregion stellt nicht nur das größte zusammenhängende Lebensraumgebiet der Erde dar, sondern ist zugleich ein zentraler Pfeiler unseres globalen Ökosystems. Trotz ihrer Bedeutung ist der Schutz der Hochsee bisher unzureichend organisiert und weltweit kaum umgesetzt. Angesichts der steigenden Umweltrisiken durch Überfischung, tiefseebasierten Rohstoffabbau und den Klimawandel steht die dringende Notwendigkeit im Raum, die Hochsee auf Dauer vor jeglicher Ausbeutung zu schützen – zum Wohle der Biodiversität, des Klimas und der Menschen weltweit. Die Hochsee fungiert als riesige Kohlenstoffsenke, die entscheidend zum Erhalt der Erdatmosphäre beiträgt.
Die darin lebenden Organismen spielen eine wichtige Rolle im sogenannten biologischen und nährstoffgetriebenen Kreislauf. Tiefseefische und zahlreiche andere Lebewesen wandern täglich zwischen den verschiedenen Meeresschichten und transportieren dabei Kohlenstoff und Nährstoffe zwischen Oberfläche und Tiefen. Ohne diesen komplexen Mechanismus wäre der atmosphärische Kohlendioxidspiegel erheblich höher, und damit verbunden die globale Durchschnittstemperatur deutlich ansteigend – was verheerende Folgen für das gesamte Ökosystem bedeuten würde. Die Geschichte der Ausbeutung der Hochsee reicht viele Jahrhunderte zurück. Schon im 17.
Jahrhundert begann die Jagd auf Wale in diesen Gewässern. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts folgte die intensive Fischerei sowie die gezielte Jagd auf Haie und Tintenfische. Diese Aktivitäten haben Berichten zufolge zu erheblichen Einbußen in den Beständen vieler bedeutender Arten geführt und ökologische Gleichgewichte nachhaltig gestört. Die Folgen sind weitreichend: bedrohte und teilweise schon ausgestorbene Tiere, zerstörte Lebensräume und eine beeinträchtigte Fähigkeit der Meere, wichtige Umweltfunktionen auszuüben.
Es ist darüber hinaus alarmierend, dass weniger als ein Prozent der Hochsee bisher unter Schutz gestellt wurde. Internationale Abkommen, etwa der 2023 verabschiedete Hochsee-Vertrag der Vereinten Nationen, der den Schutz solcher Gebiete fördern soll, sind ein Schritt in die richtige Richtung, doch wartet ihre vollständige Umsetzung noch auf den Beitritt zahlreicher Staaten und die Einrichtung konkreter Schutzmechanismen. Ebenso fehlen bislang umfassende Daten über die Ökosystemfunktionen der Hochsee und deren Bestandssituation, was eine effektive Steuerung und Regulierung erschwert. Ein massiver Ausbau der Fischerei bis in tiefere Meeresschichten und der geplante Beginn des Tiefseebergbaus bergen erhebliche Risiken. Die Zerstörung dieser kaum erforschten Ökosysteme mit ihren oft unbekannten Artenvielfalt könnte unumkehrbare Schäden anrichten und die Rolle der Ozeane bei der Stabilisierung des Klimas gefährden.
Besonders der Abbau von polymetallischen Knollen am Meeresboden entlässt gespeichertes organisches Material, das seit Jahrtausenden gebunden war, und könnte dadurch die Sauerstoffversorgung und Lebensbedingungen in weiten Regionen der Tiefsee verschlechtern. Die Fischerei in internationalen Gewässern ist durch hohe Subventionen und wenige Hauptakteure geprägt. Sechs Länder oder Regionen – China, Taiwan, Japan, Indonesien, Spanien und Südkorea – dominieren etwa 80 Prozent des Angebots der Hochseefischerei. Die Erträge sind teils nur aufgrund dieser Subventionen ökonomisch tragbar, was Fragen nach der Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit aufwirft. Negativere Aspekte sind auch die häufige Verwendung umweltschädlicher Fangmethoden, die mit verheerenden Beifangquoten bei bedrohten Arten wie Meeresschildkröten und Haien einhergehen.
Ein Verbot aller Formen der Rohstoffgewinnung und Fischerei in der Hochsee hätte vielfältige Vorteile. Die Artenvielfalt könnte sich erholen, Bestände regenerieren und durch das sogenannte Spillover verbleibender Bestände in benachbarte nationale Gewässer gelangen. Dies würde für viele Küstenstaaten, insbesondere in Entwicklungsländern, nachhaltige neue Einkommensquellen schaffen und eine gerechtere Verteilung der Ressourcen ermöglichen. Zudem würde die ökologische Stabilität der Ozeane erhalten bleiben und ihr Beitrag zum Klimaschutz gestärkt. Der Abbau von Öl, Gas und mineralischen Rohstoffen in der Hochsee ist bislang nicht kommerziell begonnen worden und angesichts der vorhandenen Vorräte in nationalen Gewässern nicht notwendig.
Außerdem ist die Gewinnung von Kohlenwasserstoffen mit Blick auf die globale Klimakrise ethisch und ökologisch fragwürdig. Der Ausbau erneuerbarer Energien macht fossile Energieträger zunehmend überflüssig. Die Ankündigungen einzelner Staaten, den Rohstoffabbau im Hochseebereich zu forcieren, stehen daher im klaren Widerspruch zum erklärten weltweiten Klimaschutz. Neben den direkten Umweltfolgen hat der unregulierte Abbau auch erhebliche soziale und wirtschaftliche Risiken. Die internationale Seebodenbehörde, die bislang die Rolle sowohl als Förderer als auch Regulierer innehat – ein klares Interessenkonfliktpotential –, präsentiert die Regulierungspolitik teilweise intransparent und wenig überprüfbar.
Dies schürt Misstrauen gegenüber zuständigen Gremien und untergräbt Möglichkeiten einer nachhaltigen, sozial verantwortlichen Ressourcennutzung. Vielerorts formiert sich Widerstand gegen die Kommerzialisierung der Hochseeausbeutung. Wissenschaftliche Erkenntnisse und die zunehmende internationale Zustimmung sprechen für einen globalen Moratorium oder gar ein dauerhaftes Verbot von Tiefseebergbau und Fischerei in internationalen Gewässern. Neben wissenschaftlichen Organisationen und Umweltschutzverbänden unterstützen mittlerweile über 30 Staaten diese Forderung. Der Schutz der Hochsee ist eine Herausforderung der globalen Gemeinschaft, die über nationale Interessen hinausgeht.
Analog zum Schutz der Antarktis im vergangenen Jahrhundert bedarf es politischer Vision, gemeinsamer Werte und völkerrechtlicher Rahmenwerke, die nachhaltigen Umweltschutz in den Mittelpunkt stellen. Nicht zuletzt erfordert dies den Schutz unserer gemeinsamen Erdsysteme zum Wohle jetziger und zukünftiger Generationen. Internationale Zusammenarbeit ist unerlässlich, um diesen gigantischen Lebensraum vor weiteren Schäden zu bewahren. Nur durch kompromisslose Schutzmaßnahmen und die Einhaltung des Vorsorgeprinzips kann sichergestellt werden, dass die Hochsee nicht zum Kollaps gebracht wird. Ihr Schutz unterstützt nicht nur die Biodiversität sondern ist auch ein essenzieller Beitrag zum Klimaschutz und damit zur Wahrung der globalen Lebensgrundlagen.
In Zeiten des rasant fortschreitenden Klimawandels und des massiven Artenverlusts stehen wir vor der Wahl, ob wir als Gesellschaft bereit sind, die Hochsee als eine der letzten intakten Naturräume zu erhalten oder sie weiter auszubeuten und für künftige Generationen unzugänglich und verlassen zu hinterlassen. Die Argumente sprechen eindeutig dafür, sofort und dauerhaft Maßnahmen zum Schutz der internationalen Gewässer zu ergreifen. Dass der Schutz der Hochsee möglich ist, hat die Geschichte bereits mit der Antarktis gezeigt. Es ist an der Zeit, dieses Vorbild zu nehmen und sich gemeinsam für den dauerhaften Schutz der Hochsee einzusetzen.