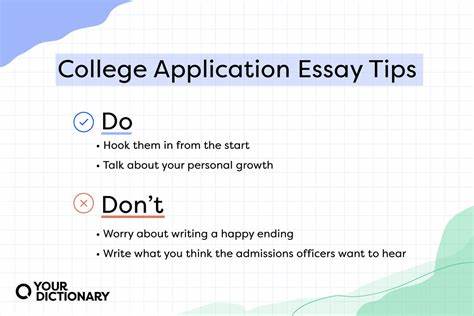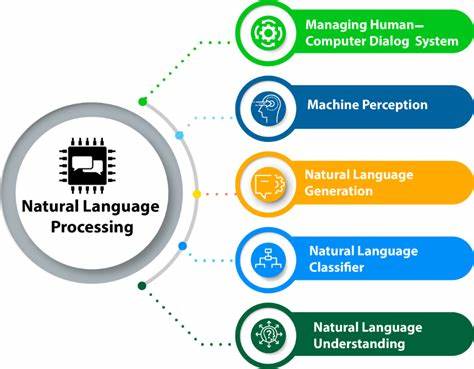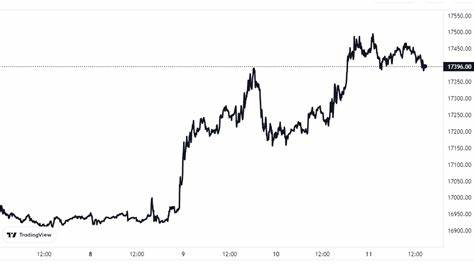In der Welt der Startups und Venture Capital (VC) gehört es schon fast zum traurigen Alltag: Gründer sehen sich gezwungen, neben ihrem ohnehin oft knappen Budget auch noch die juristischen Kosten der entgegenstehenden VC-Anwälte zu übernehmen. Diese Situation ist nicht nur unangenehm, sondern stellt auch ein grundlegendes Missverhältnis dar, das viele Gründer finanziell und psychisch belastet. Dabei müsste es nicht so sein – und es gibt immer mehr Stimmen, die sich gegen diese Praxis wehren. Die Idee, dass Startups die Anwaltskosten ihrer Investoren tragen sollten, ist in der VC-Szene weit verbreitet. Gerade bei größeren Finanzierungsrunden kann dies leicht Kosten in Höhe von 50.
000 bis 100.000 US-Dollar bedeuten. Ein solcher Betrag entspricht dem Gehalt eines erfahrenen Softwareentwicklers für mehrere Monate, die nun also unmittelbar aus den Mitteln des Startups für die Juristen der Investoren ausgegeben werden. Diese Ausgabe schmälert nicht nur das Kapital der Gründer, sondern wirkt sich auch unmittelbar auf die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Unternehmens aus. Die Befürworter dieser Praxis argumentieren oft, dass juristische Transparenz und Fairness gewahrt werden müssten und dass die Kosten für Vertragsgestaltung und Verhandlung eben dazugehören.
Das Problem daran ist jedoch, dass diese Kosten vielfach nicht die resultierende Qualität der Verhandlung oder des Vertrags widerspiegeln. Vielmehr motiviert die Festsetzung von Kostenobergrenzen bei Anwälten dazu, bis zum Erreichen dieser Grenzen abzurechnen – ganz im Sinne von Parkinsons Gesetz, nach dem sich die Arbeit genau der zur Verfügung stehenden Zeit anpasst. Aus Sicht der Gründer entsteht so eine toxische Dynamik. Sie befinden sich in einer Verhandlungsposition, in der sie nicht selten auf die Mittel der VC-Investoren angewiesen sind, aber dennoch für die juristischen Gebühren der Gegenseite aufkommen sollen. Vergleichbar ist das damit, einer befreundeten Person ein Abendessen anzubieten und anschließend zu verlangen, dass sie für die Zutaten aufkommt.
Es widerspricht dem Prinzip eines unterstützenden, partnerschaftlichen Verhältnisses. Noch gravierender wird die Situation, wenn man die Perspektive der Anteilseigner einnimmt und insbesondere die der Limited Partners (LPs), die in die VC-Fonds investieren. Diese zahlenden Investoren erwarten, dass ihre Mittel transparent und verantwortungsvoll eingesetzt werden. Doch das Verlegen der juristischen Kosten auf das Portfolio-Unternehmen stellt einen Umweg dar, durch den diese Kosten den LPs oft verschleiert bleiben. Die dadurch entstehenden Ausgaben werden häufig nicht explizit aufgeführt, was eine angemessene Kontrolle und Prüfung erschwert oder unmöglich macht.
Die betroffenen Unternehmungen werden so doppelt belastet: Zum einen gehen den Gründern und ihren Mitgesellschaftern Mittel verloren, die für Wachstum und Innovation gedacht sind. Zum anderen werden die LPs unfreiwillig zur Finanzierung der damit verbundenen Kosten herangezogen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Eine solch intransparente Handhabung widerspricht dem Geist einer offenen und verantwortlichen Kapitalverwendung. Warum aber hält sich dieses Vorgehen trotz seiner offensichtlichen Nachteile für Gründer und Investoren? Die simple Antwort lautet: Es funktioniert – zumindest solange keine Gegenwehr erfolgt. Gründer in der meist schwächeren Verhandlungsposition scheuen es vielfach, diesem Standard zu widersprechen, aus Angst, den Deal zu verlieren oder schwierige Verhandlungen provozieren zu müssen.
VCs wiederum bleiben bei der Praxis, weil sie finanziell vorteilhaft ist und nur selten ernsthafte Einwände provoziert. Doch Ausnahmen bestätigen die Regel. Eine Reihe von Venture-Capital-Firmen – darunter einige namhafte europäische Fonds, Flex Capital und auch Y Combinator – haben sich dazu entschlossen, diese Praxis bewusst nicht anzuwenden und tragen ihre Anwaltskosten selbst. Diese Haltung verdeutlicht, dass es sich bei der Forderung nach Erstattung nicht um eine unvermeidbare Kostenstruktur handelt, sondern um ein selbst auferlegtes Geschäftsmodell, das geändert werden kann. Für Gründer heißt dies: es ist an der Zeit, mutiger zu verhandeln.
Bereits die eindeutige Aufnahme eines Postens „Rechtskosten: 0 US-Dollar, Kosten übernimmt Investor“ in den Term Sheet kann Druck erzeugen und die Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken. Ein weiterer kreativer Ansatz wäre eine Vertragsklausel, die für Verzögerungen beim Abschluss der Finanzierung infolge der Investorenanwaltskanzlei eine Strafzahlung vorsieht. So steigt die Motivation, den Prozess zügig und ohne unnötige Kosten zu gestalten. Darüber hinaus sind etablierte Akteure wie Y Combinator gefordert, ihre Position als Meinungsführer zu nutzen und Investoren klar zu machen, dass Gründer unter den heutigen Bedingungen ihr Engagement neu bewerten und weniger geneigt sein werden, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die auf diese unfaire Gebühr bestehen. Auch die großen Limited Partners sollten mehr Druck ausüben und vollständige Transparenz bei allen abgerechneten Kosten einfordern.
Die Diskussion um die Erstattung der Anwaltskosten seitens der Gründer spiegelt ein grundlegendes Machtungleichgewicht im Venture-Capital-Markt wider. Initiativen, die darauf abzielen, diese Praxis zu beenden, stehen für einen respektvollen Umgang mit Gründern und eine nachhaltige Beziehung zwischen Kapitalgebern und Unternehmern. Letztlich profitieren alle Beteiligten von einer fairen und transparenten Kostenteilung, die Innovationen fördert, statt sie zu belasten. Abschließend ist zu sagen, dass Gründer grundsätzlich verhandlungsfähig sind und keine Angst haben sollten, unvorteilhafte Bedingungen infrage zu stellen. Die Übernahme der Anwaltskosten der Investoren hat keinerlei Rechtfertigung, sondern ist vielmehr ein Relikt einer weniger rücksichtsvollen Branche.
Moderne Investoren sollten sich als Partner verhalten, die gemeinsam mit den Gründern an einem Strang ziehen und nicht zusätzlich Kosten auf deren Schultern abladen. Die Zukunft der Gründerszene verlangt mehr Transparenz, mehr Fairness und deutlich mehr Respekt vor den Herausforderungen, die Startups jeden Tag meistern. Gelingt der Wandel hin zu einer solchen Kultur, wächst nicht nur das Vertrauen, sondern auch die Innovationskraft und das Wachstum aller Beteiligten – der erste Schritt dahin beginnt mit dem Mut, unfaire und veraltete Praktiken zu beenden.