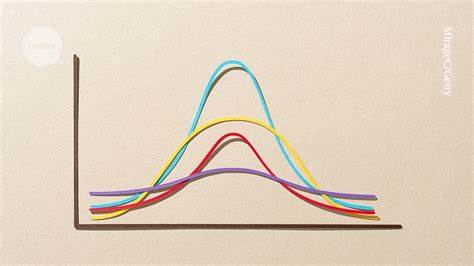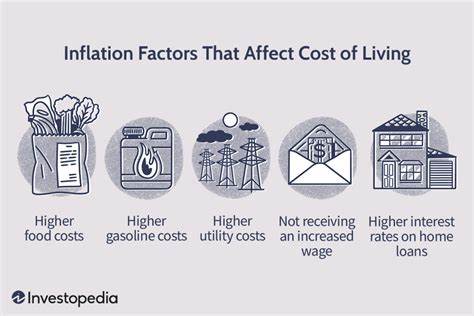In der Welt der Forschung ist das Streben nach signifikanten Ergebnissen enorm. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler möchten ihre Hypothesen bestätigen und Erkenntnisse veröffentlichen, die Gültigkeit und Relevanz besitzen. Dabei spielt der sogenannte P-Wert, ein statistisches Maß, eine entscheidende Rolle. Er gibt an, wie wahrscheinlich ein Ergebnis unter der Annahme der Ungültigkeit der Nullhypothese zufällig zustande gekommen ist. Ein P-Wert unter 0,05 gilt oft als Hinweis auf eine statistisch signifikante Entdeckung.
Doch genau hier liegt eine gefährliche Versuchung verborgen: P-Hacking. Unter P-Hacking versteht man die bewusste oder unbewusste Manipulation von Forschungsdaten und Analysen, um einen „signifikanten“ P-Wert zu erreichen. Für viele Forscher kann der Druck, in hochrangigen Zeitschriften zu veröffentlichen, solche Praktiken verlockend machen. P-Hacking verzerrt die wissenschaftliche Wahrheitsfindung und trägt dazu bei, dass falsche positive Ergebnisse veröffentlicht werden. All das untergräbt das Vertrauen in Forschungsergebnisse.
Es ist deshalb entscheidend, die vielfältigen Wege zu kennen, wie P-Hacking entstehen kann, um diese zu erkennen und zu vermeiden. Ein häufiges Szenario ist das häufige Testen der Daten während der Datenerhebung. Forscher sehen sich Zwischenergebnisse an, um zu überprüfen, ob der P-Wert schon unter 0,05 gefallen ist. Das Problem hierbei ist, dass bei wiederholtem Nachsehen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zufällig „signifikante“ Ergebnisse gefunden werden — auch wenn tatsächlich keine echte Effekte vorliegen. Dadurch steigt die Gefahr, Ergebnisse zu präsentieren, die nur durch Datenpeeks zustande kommen, was die statistische Inferenz verzerrt und das Risiko von Fehlinterpretationen erhöht.
Weitere Formen des P-Hackings entstehen, wenn mehrere Analysewege ausprobiert werden, bis ein erfreuliches Ergebnis auftaucht. Man spricht dann von mehreren Tests oder Variationen, die explorativ durchgeführt werden. Beispielsweise kann die Auswahl bestimmter Subgruppen, die Verwendung unterschiedlicher Kovariablenmodelle, das Festlegen verschiedener Grenzwerte oder die Veränderung von Analysemethoden systematisch auf Messgrößen abgestimmt werden, die den gewünschten P-Wert liefern. Ohne vorher festgelegte Analysepläne wird so die Gültigkeit statistischer Annahmen verletzt. Daneben findet häufig eine selektive Berichterstattung statt.
Studien oder Analysen, die keine signifikanten Ergebnisse zeigen, bleiben oft unerwähnt oder werden erst gar nicht veröffentlicht. Dieses sogenannte Publication Bias führt zu einer verzerrten Gesamtlage des Forschungsstands und lässt wichtige negative Befunde verschwinden. Auch manipulative Datenbehandlung wie das Entfernen von Ausreißern oder Fällen, die nicht zum erwarteten Ergebnis passen, fällt unter P-Hacking, wenn es nicht transparent und wissenschaftlich begründet geschieht. Hierbei werden Studienergebnisse unzulässig „geglättet“, um signifikante Ergebnisse zu erzielen. Eine weitere Gefahr ist der opportunistische Umgang mit Variablen-Definitionen.
Wenn Forschungsfragen so angepasst werden, dass die Daten zum gewünschten Ergebnis passen, oder wenn Variablenpost-hoc umkodiert werden, entsteht ein verzerrtes Bild und der P-Wert verliert seine Aussagekraft. Die Vielzahl dieser Praktiken zeigt, dass P-Hacking keine absichtliche Täuschung sein muss, sondern auch aus mangelndem Bewusstsein für richtige Methodik oder aus Druck entstehen kann. Wissenschaftliche Integrität erfordert deshalb Transparenz, feste Analysepläne und eine Offenlegung aller durchgeführten Tests und Entscheidungen. Um P-Hacking effektiv vorzubeugen, hat sich die Registrierung von Studien, sogenannte Pre-Registration, bewährt. Dabei werden Forschungsfragen, Hypothesen und Analyseverfahren vor Beginn festgelegt und öffentlich gemacht.
So wird die Versuchung reduziert, Daten nachträglich zu manipulieren, und die Validität der Ergebnisse steigt. Auch die Nutzung von offenen Daten und Analyseprotokollen stärkt die Nachvollziehbarkeit wissenschaftlicher Studien. Darüber hinaus sollten Forscher verstärkt durch Weiterbildungen in Statistik und Methodik unterstützt werden, um das Bewusstsein für häufige Fehlerquellen zu erhöhen. Peer-Review-Reviewer und Journal-Redakteure spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, indem sie auf transparente Berichtserstattung und die Einhaltung methodischer Standards achten. Wissenschaftliche Gemeinschaften fördern darüber hinaus die Anerkennung von Studien mit nicht-signifikanten Ergebnissen, um den Publikationsdruck zu mildern und ein realistisches Gesamtbild der Forschung zu gewährleisten.