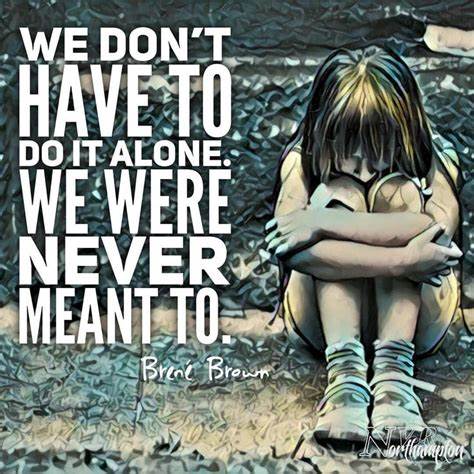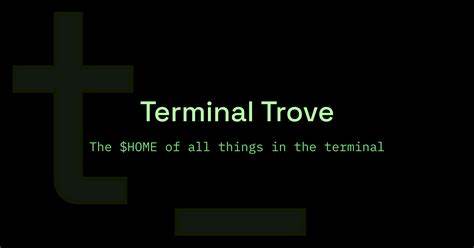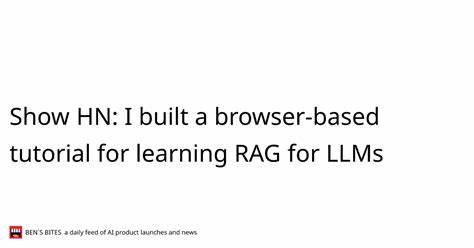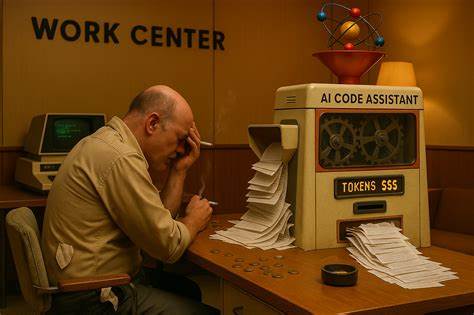Entwicklungshilfe ist ein weltweit bedeutendes Instrument, mit dem wohlhabende Länder ärmere Regionen unterstützen, um deren wirtschaftliche Entwicklung und das Wohlergehen der Menschen vor Ort zu fördern. Dabei gilt es jedoch, genau zu verstehen, was unter Entwicklungshilfe zu verstehen ist und wie deren Umfang und Wirksamkeit gemessen werden. Der technische Begriff, der oft synonym verwendet wird, lautet "Offizielle Entwicklungszusammenarbeit", kurz ODA (Official Development Assistance). Diese Bezeichnung stammt von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der OECD, die als eine der wichtigsten Institutionen globaler Zusammenarbeit genaue Rahmenbedingungen und Messstandards für Entwicklungshilfe definiert hat. Nur wenn Hilfsleistungen den Kriterien dieser Organisation entsprechen, werden sie offiziell als ODA erfasst.
Grundsätzlich muss für eine Ausgabe das Hauptziel die Förderung von wirtschaftlicher Entwicklung und sozialem Wohlstand in Entwicklungsländern sein, damit sie als ODA gezählt wird. Diese offizielle Definition hat weitreichende Folgen, denn sie bestimmt, welche Finanzflüsse als wirkliche Entwicklungsbeiträge registriert und weltweit verglichen werden können. Die meisten Geberländer, insbesondere die Mitgliedsstaaten des sogenannten DAC (Development Assistance Committee), der aus 31 Ländern und der Europäischen Union als Institution besteht, folgen diesen Standards. 2022 kamen knapp 94 Prozent der offiziell gemeldeten Entwicklungshilfegelder von diesen DAC-Mitgliedern. Es gibt jedoch auch Länder wie die Türkei, Saudi-Arabien oder Katar, die freiwillig Daten melden, obwohl sie keine DAC-Mitglieder sind.
Grundsätzlich wird deshalb in der Debatte oft von „Geberländern“ gesprochen, die gemeinsam die globale Entwicklungshilfe gestalten. Die genaue Messung von ODA ist eine komplexe Aufgabe. Sie bezieht sich nicht nur auf das reine Volumen der bereitgestellten Mittel, sondern auch auf deren Zusammensetzung und den Verwendungszweck. Ein bedeutender Anteil dieser Mittel wird in Form von direkten Zuschüssen oder zweckgebundenen Geldleistungen gewährt, die ohne Rückzahlung an Entwicklungsländer fließen. Dies ist die häufigste Form staatlicher Entwicklungshilfe.
Daneben existieren sogenannte „konzessionale Kredite“, also zinsgünstige Darlehen, deren günstiger Zins im Vergleich zu marktüblichen Bedingungen als Hilfsleistung bewertet wird. Hierbei wird die „Förderkomponente“ oder der „Zuschussequivalentwert“ berechnet, um den echten Hilfsanteil zu bestimmen. Diese Methode ist jedoch mit Herausforderungen verbunden, da ihre Komplexität und Bewertungsbasis immer wieder diskutiert wird. So werden beispielsweise oft Zweifel geäußert, ob die derzeitigen Regeln bestimmte Kreditarten begünstigen und auf Kosten der ärmsten Länder auch Kredite an mittelverdienende Länder attraktiv erscheinen lassen. Trotzdem machen diese concessionalen Kredite nur einen kleinen Teil des gesamten ODA-Volumens aus, sodass die überwiegende Mehrheit der Entwicklungshilfe als Zuschüsse erfolgt.
Neben der Art der Finanzmittel ist auch die Unterscheidung zwischen langfristiger Entwicklungszusammenarbeit und kurzfristiger humanitärer Hilfe zentral. Die meisten ODA-Mittel unterstützen Projekte, die über Jahre auf den Ausbau von Infrastruktur, Bildung, Gesundheit, Wasser- und Sanitärversorgung zielen. Solche Investitionen fördern die nachhaltige Entwicklung. Öfters sind dies Projekte im Bereich sozialer Infrastruktur, die rund ein Drittel der gesamten ODA-Ausgaben ausmachen. Daneben fließt ein bedeutender Teil der Mittel in wirtschaftliche Infrastruktur sowie produktionsbezogene Sektoren.
Diese zielgerichteten Hilfsmaßnahmen sind grundlegend für die Entwicklung von Humankapital und die Verbesserung der Lebensqualität in den Partnerstaaten. Gleichzeitig ist Entwicklungshilfe auch wichtig bei der Bewältigung von Krisensituationen. Humanitäre Hilfe, die beispielsweise bei Naturkatastrophen, Konflikten oder Flüchtlingsbewegungen geleistet wird, gehört zum ODA-Konto, sofern sie den klaren Kriterien entspricht. Im Jahr 2023 belief sich der Anteil humanitärer Hilfe an den gesamten ODA-Budgets wohlhabender Länder auf etwa zwölf Prozent. Trotz dieses bedeutenden Beitrags besteht oft eine erhebliche Finanzierungslücke bei humanitären Einsätzen.
So meldet der Global Humanitarian Overview für das Jahr 2024 eine Differenz von 36 Milliarden US-Dollar zwischen dem tatsächlichen Bedarf und den vorhandenen Mitteln. Werden die ODA-Hilfen ausgeweitet, ließen sich diese Lücken idealer überbrücken, ohne langfristige Entwicklungsprojekte zu gefährden. Eine weitere interessante Facette der ODA-Messung bezieht sich darauf, wie viel des Entwicklungshilfegeldes tatsächlich in betroffenen Entwicklungsländern ausgegeben wird und wie viel innerhalb der Geberländer verbleibt. Überraschenderweise erlauben die OECD-Regeln, dass bestimmte Ausgaben für Entwicklungshilfe anerkannt werden, auch wenn sie innerhalb der Geberstaaten getätigt werden. Dazu zählen vor allem Kosten für die Aufnahme und Betreuung von Geflüchteten in ihren ersten zwölf Monaten nach der Ankunft.
Auch Stipendien für ausländische Studierende können unter bestimmten Bedingungen in die ODA-Rechnung einfließen, wenn sie mit den Entwicklungszielen der Gastländer übereinstimmen. Diese innerstaatlichen Kosten machen bei einigen Gebern eine bedeutende Position ein. So geben zum Beispiel Länder wie Irland und einige andere DAC-Länder 20 Prozent oder mehr ihrer ODA-Mittel für inländische Ausgaben aus. Im Vergleich dazu liegt der Anteil bei der Bundesrepublik Deutschland und insbesondere bei Großbritannien etwas geringer, im Vergleich dennoch signifikant. Allerdings wird diese Praxis insbesondere bei den Ausgaben für Geflüchtete auch kritisch diskutiert, da nach Ablauf der zwölfmonatigen Anrechnungsfrist diese Kosten nicht mehr in der ODA berücksichtigt werden.
Ebenfalls klar ausgeschlossen aus der ODA sind militärische Unterstützungsleistungen. Keiner der DAC-Staaten darf seine Militärhilfe als Entwicklungshilfe anrechnen. Die strikte Trennung hilft dabei, die Entwicklungshilfe von geopolitischen oder militärischen Interessen zu entkoppeln und verzerrte Darstellungen zu vermeiden. Allerdings existiert eine Ausnahme: Bis zu 15 Prozent der Ausgaben für Friedensmissionen, die durch die Vereinten Nationen organisiert werden, können als ODA gewertet werden, da diese Einsätze klare Entwicklungsziele verfolgen und auf multilateralen Rahmenbedingungen basieren. Gerade in Zeiten von Konflikten, wie dem Krieg in der Ukraine, wird diese Differenzierung besonders deutlich: Die massive militärische Unterstützung durch die USA wird nicht in die ODA-Zahlen einbezogen, während Entwicklungshilfe für humanitäre Notlagen oder wirtschaftliche Unterstützung weiterhin Teil der offiziellen Zahlen bleibt.
Die meisten Entwicklungshilfemittel stammen aus öffentlichen Haushalten, also direkt von Regierungen oder über multilaterale Organisationen an Partnerländer weitergegeben. Private Spenden etwa von Stiftungen wie der Bill & Melinda Gates Foundation oder der LEGO Stiftung werden nicht als ODA gewertet, obwohl sie einen wichtigen Beitrag zur globalen Entwicklungszusammenarbeit leisten können. Diese sogenannten philanthropischen Beiträge sind mengenmäßig aber wesentlich geringer als die staatlich finanzierten Mittel. Für 2022 wird geschätzt, dass private ODA-finanzierte Maßnahmen im OECD-Raum etwa zwanzigmal kleiner waren als die öffentlichen ODA-Zahlungen. Daraus lässt sich ableiten, dass in demokratischen Ländern die politische Willensbildung und die Steuerpolitik der gewählten Regierungen entscheidend darüber sind, wie viel Entwicklungshilfe bereitgestellt wird.
Trotz der umfassenden OECD-Standards gibt es Einschränkungen bei der Messung von Entwicklungshilfe. Die Erhebung von ODA-Daten erfolgt hauptsächlich durch reiche OECD-Länder, wodurch wichtige Akteure wie China bisher kaum in offiziellen Statistiken erscheinen. China ist zwar mittlerweile eine der größten Volkswirtschaften der Welt, meldet aber seine Entwicklungshilfe nicht im OECD-System. Um diese Lücke zu schließen, entstand der Ansatz „Finance for International Development“ (FID), der traditionelle Geberländer wie die USA mit neuen Gebern wie China vergleichbar machen soll. Analysen zeigen, dass China zwar gemessen an ODA deutlich geringere Summen meldet, mit dem umfassenderen FID-Ansatz jedoch zu den bedeutendsten Gebern gehört.
Auch andere Arten von Finanzflüssen, sogenannte „Other Official Flows“ (OOF), die nicht alle ODA-Kriterien erfüllen – etwa kommerziell orientierte Investitionen oder entwicklungspolitisch weniger großzügige Kredite – erhöhen das tatsächliche Finanzvolumen, das von Ländern in Entwicklungsmärkte fließt. Die Berücksichtigung dieser Daten ermöglicht ein vollständigeres Verständnis der globalen Entwicklungsfinanzierung. Insgesamt ist die Messung der offiziellen Entwicklungszusammenarbeit ein komplexes, aber notwendiges Unterfangen für die internationale Zusammenarbeit und die transparente Nachverfolgung von Entwicklungshilfen. Die OECD-Standards schaffen einen einheitlichen Rahmen, der Vergleiche zwischen Ländern möglich macht und die Mittelverwendung detailliert offenlegt. Kritische Diskussionen über die Definition von Hilfe, die Berücksichtigung von inländischen Ausgaben und die Rolle neuer Akteure zeigen, dass es ein sich stetig weiterentwickelndes Feld bleibt.
Ein fundiertes Verständnis der ODA-Messung ist essenziell, um die Wirkung von Entwicklungshilfe richtig einzuschätzen und den globalen Fortschritt in Armutsbekämpfung, Gesundheit, Bildung und Infrastruktur nachhaltig zu fördern.