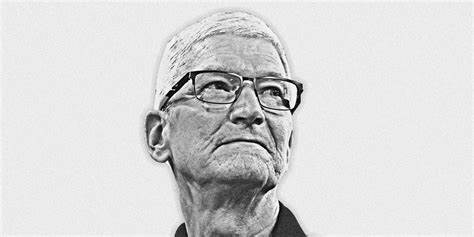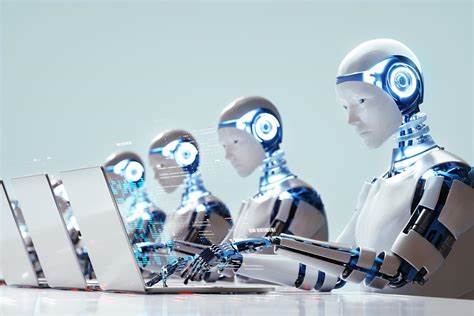In den letzten zehn Jahren haben sich die Kompetenzen von Erwachsenen in den grundlegenden Bereichen der Alphabetisierung und Mathematik in den meisten Mitgliedsländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) nicht verbessert – in vielen Fällen stagnieren sie sogar oder nehmen ab. Diese Entwicklung wirft alarmierende Fragen für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaften auf, denn Lesefähigkeit und Rechenkenntnisse gelten als essenzielle Voraussetzung für die berufliche Integration, wirtschaftlichen Erfolg und gesellschaftliche Teilhabe. Die jüngsten Daten aus der zweiten internationalen Umfrage zu erwachsenen Fähigkeiten der OECD zeichnen ein klares Bild: Trotz gezielter Investitionen in Bildung und Erwachsenenqualifizierung haben nur wenige Länder signifikante Fortschritte erzielt. Dabei zeigt sich, dass gerade die am schwächsten ausgebildeten Bevölkerungsgruppen von Verschlechterungen betroffen sind, was auf wachsende soziale Ungleichheiten hinweist. Die Umfrage, die rund 160.
000 Erwachsene im Alter zwischen 16 und 65 Jahren in 31 Ländern untersucht hat, veranschaulicht nicht nur das Ausmaß der Problematik, sondern unterstreicht auch die Dringlichkeit eines neuen Bildungskonzepts, das der dynamischen Arbeitswelt und gesellschaftlichen Anforderungen besser gerecht wird. Der Einfluss von lebenslangem Lernen wird zunehmend bedeutsam, da technologische Veränderungen und Digitalisierung neue Kompetenzen erfordern und traditionelle Fertigkeiten ergänzen oder teilweise ersetzen. Finnland und Dänemark stechen im OECD-Vergleich als Länder hervor, die positive Entwicklungsschritte bei den Lesefähigkeiten ihrer erwachsenen Bevölkerung verzeichnen konnten. Auch in puncto mathematische Fähigkeiten konnten einige Länder, unter anderem Finnland und Singapur, Verbesserungen erzielen. Dennoch bleibt der Großteil der Mitgliedsstaaten hinter diesen progressiven Beispielen zurück, was eine heterogene Landschaft widerspiegelt, die von unterschiedlich starken Bildungssystemen und politischen Prioritäten geprägt wird.
Die Tatsache, dass vor allem die Fertigkeiten der 10 Prozent der niedrigstqualifizierten Erwachsenen im Bereich Lesen und Rechnen zurückgehen, ist besonders besorgniserregend. Damit wächst die Sprach- und Rechenschwäche in breiten Bevölkerungsschichten und erschwert die Integration dieser Gruppen in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft. Zugleich zeigen sich zunehmende Fertigkeitsunterschiede zwischen den leistungsstärksten und leistungsschwächsten Erwachsenen, was auf eine Verstärkung sozialer Ungleichheiten innerhalb der Länder hindeutet. Besonders auffällig sind die gravierenden Kompetenzgefälle in Singapur und den Vereinigten Staaten, wo die Klüfte zwischen den Top- und Bottom-Performern in den Bereichen Lesen und Rechnen am größten sind. Die Auswirkungen von mangelnden Grundkompetenzen sind vielschichtig.
Auf individueller Ebene bedeutet dies häufig unsichere Beschäftigungsverhältnisse, niedrigere Einkommen und gesundheitliche Nachteile. Menschen mit höheren numerischen Fähigkeiten neigen hingegen dazu, nicht nur bessere Berufschancen zu genießen, sondern auch größere Zufriedenheit im Leben zu erfahren und eine bessere gesundheitliche Situation aufzuweisen. Diese Zusammenhänge stellt der Generalsekretär der OECD, Mathias Cormann, klar heraus. Er sieht in den erwachsenen Grundkompetenzen einen Eckpfeiler für einen widerstandsfähigen und inklusiven Arbeitsmarkt, der die wirtschaftliche Prosperität langfristig sichert. Neben der Bildungsförderung aller Bürgerinnen und Bürger ist die soziale Herkunft weiterhin ein bedeutender Determinant für die Ausprägung von Lese- und Rechenfähigkeiten.
In vielen Ländern hängen die Chancen auf gute Grundkompetenzen sehr stark vom familiären Hintergrund ab, wodurch Ungleichheiten über Generationen hinweg reproduziert werden. Diese Feststellung macht eine gezielte Förderung besonders benachteiligter Gruppen notwendig. Geschlechterunterschiede in den grundlegenden Fähigkeiten werden ebenfalls deutlich. Während sich die Lese- und Schreibkompetenzen von Männern über das letzte Jahrzehnt eher verschlechtert haben und die Kluft zu den Frauen kleiner geworden ist, liegt weiterhin eine höhere Leistungsfähigkeit der Männer im Bereich der Mathematik und des Problemlösens vor. Auch Migration spielt eine entscheidende Rolle in der Diskussion um erwachsene Grundkompetenzen.
In nahezu allen untersuchten Ländern schneiden gebürtige Menschen besser ab als Personen mit Migrationshintergrund. Die wachsende Zahl von im Ausland geborenen Erwachsenen trägt an einigen Orten zu einem Rückgang der durchschnittlichen Kompetenzwerte bei, was die politische Debatte über Integration und Bildungsförderung im Kontext von Migration verschärft. Einige Länder wie Finnland, Japan, die Niederlande, Norwegen und Schweden gelten als Vorbilder, da ihre Bevölkerung in allen drei Kernbereichen – Lesen, Rechnen und Problemlösen – im internationalen Vergleich besonders stark abschneidet. Die Strategien dieser Länder können als Erfolgsmodelle für andere Staaten dienen, die vor der Herausforderung stehen, die Grundkompetenzen ihrer Bürger zu verbessern. Gleichzeitig zeigen Länder wie Frankreich, Italien, Korea, Spanien und Chile durchweg unterdurchschnittliche Werte, was einen dringenden Handlungsbedarf in Bildungspolitik und Erwachsenenqualifizierung aufzeigt.
Die OECD-Studie fordert einen umfassenden Strategiewechsel im Umgang mit der Vermittlung von Grundkompetenzen. Neben der Verbesserung der schulischen Bildungssysteme ist vor allem die Entwicklung flexibler und erreichbarer Möglichkeiten zur Erwachsenenqualifizierung essenziell. Bildungspolitik sollte dabei verstärkt auf digitale Lernformen setzen, um auch weniger produktive oder benachteiligte Gruppen zu erreichen. Die Rolle von Arbeitsplätzen als Lernorte gewinnt angesichts der Digitalisierung an Bedeutung, denn der Erwerb und die Anwendung von Grundkompetenzen am Arbeitsplatz tragen entscheidend dazu bei, die Fähigkeiten dauerhaft zu erhalten und auszubauen. Die Zunahme der Automatisierung und Künstlichen Intelligenz fordert ein Umdenken darin, welche Kernkompetenzen wirklich zukunftsfähig sind.
Während früher reines Faktenwissen im Vordergrund stand, gewinnen heute Problemlösefähigkeiten, kritisches Denken und die Fähigkeit zur Selbstorganisation an Wichtigkeit – Fähigkeiten, die eng mit soliden Basiskenntnissen in Lesen und Rechnen verknüpft sind. Die Stagnation oder gar der Rückgang von Grundkompetenzen bei Erwachsenen ist somit nicht nur ein Bildungsproblem, sondern eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die Arbeitsmarkt, Wirtschaft und soziale Integration betrifft. Effiziente Lösungsansätze müssen das kooperative Handeln von Regierungen, Arbeitgebern, Bildungseinrichtungen sowie sozialen Partnern und der Zivilgesellschaft umfassen. Eine lebenslange Lernkultur, die bereits in der schulischen Ausbildung verankert ist und durch kontinuierliche Weiterbildung im Berufsleben ergänzt wird, kann dazu beitragen, die aktuelle Entwicklung umzukehren. Nur so lassen sich den wachsenden Anforderungen einer sich schnell verändernden Arbeitswelt gerecht werden und soziale Ungleichheiten reduzieren.
Die OECD-Analyse mahnt, die Aufgabe zur Verbesserung der Grundkompetenzen nicht als kurzfristiges Projekt zu betrachten, sondern als langfristige Investition in die humanen Ressourcen und den sozialen Zusammenhalt. Die Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaften hängt maßgeblich davon ab, wie gut es gelingt, grundlegende Fähigkeiten breitflächig zu fördern und weiterzuentwickeln. Bildung muss daher als zentrales Element einer Sozial- und Wirtschaftspolitik verstanden werden, die alle Bevölkerungsgruppen erreicht und Chancengleichheit gewährleistet. Die Herausforderung für die kommenden Jahre wird darin bestehen, innovative Bildungsstrategien zu entwickeln, die den individuellen Bedürfnissen erwachsener Lernender entsprechen und sie befähigen, sich flexibel an sich wandelnde berufliche Anforderungen anzupassen. Technologische Unterstützung, personalisierte Lernangebote und der Abbau von Barrieren für benachteiligte Gruppen können dabei entscheidende Faktoren sein.
Deutschland und andere europäische Länder sollten aus den Erfahrungen der OECD-Länder lernen, die bereits signifikante Fortschritte bei den Basisfähigkeiten verzeichnen konnten. Gleichzeitig muss der Fokus noch stärker auf integrative Bildungspolitik gelegt werden, die Migration, soziale Herkunft und Geschlechterunterschiede berücksichtigt und gezielt angeht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die stagnierenden oder rückläufigen Grundkompetenzen ein Weckruf für alle Gesellschaften sind. Angesichts der zunehmenden Bedeutung von lebenslangem Lernen und Digitalisierung sind verstärkte Investitionen in die Förderung der Lese- und Rechenfähigkeiten von Erwachsenen unverzichtbar. Nur so kann sichergestellt werden, dass alle Menschen die nötigen Werkzeuge besitzen, um aktiv, produktiv und zufrieden in einer komplexen, sich stetig wandelnden Welt zu agieren.
Die Zukunft gehört denen, die lernen – und davon hängen Fortschritt und sozialer Zusammenhalt gleichermaßen ab.