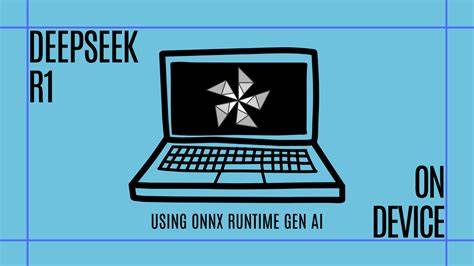Die Generation der späten Babyboomer, geboren zwischen Mitte der 1950er und Mitte der 1960er Jahre, befindet sich heute in einer besonders prekären Lebenslage, die sich direkt auf die alarmierende Zunahme der Obdachlosigkeit unter älteren Menschen auswirkt. Jahrzehntelang haben diese Menschen unter einer Vielzahl wirtschaftlicher und sozialer Herausforderungen gelitten, die nun zusammenkommen und zu einem beispiellosen Anstieg der Wohnungslosigkeit geführt haben. Das Phänomen ist nicht nur ein Zeichen individueller Schicksale, sondern spiegelt tiefergreifende gesellschaftliche und wirtschaftliche Probleme wider, die einer eingehenden Betrachtung bedürfen. Einer der tragischsten Aspekte ist der Verlust der elterlichen Unterstützung, die für viele späte Babyboomer lange Zeit die letzte stabile Säule bildete. Die meisten von ihnen sind in einer Zeit aufgewachsen, in der das Aufwachsen in einer stabilen Familie mit Unterkunft gesichert war, doch nun nimmt die Generation Abschied von ihren oft hochbetagten Eltern, deren Tod oder gesundheitliche Verschlechterung das Ende der finanziellen und emotionalen Rückendeckung bedeutet.
Dieser Verlust erzeugt eine Kettenreaktion, die viele dazu zwingt, auf der Straße zu leben, nachdem sie zuvor zumindest in bescheidenem Maße abgesichert waren. Anthony Forrest, ein exemplarischer Vertreter dieser Generation, ist ein lebendiges Beispiel für diese Entwicklung. Nach dem Umzug seiner Mutter in ein Pflegeheim verlor er seine Bleibe, die diese bis dahin finanziert hatte. Seine Geschichte verdeutlicht, wie eng verknüpft persönliche Schicksale mit strukturellen Herausforderungen sind. Die späten Babyboomer kamen in eine Welt, die sich rasant veränderte: Ökonomische Ungleichheit nahm zu, der Arbeitsmarkt wandelte sich durch den Übergang zur Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft, und niedrig qualifizierte Arbeitsplätze wurden seltener.
Gleichzeitig explodierten die Mietpreise, insbesondere in urbanen Zentren, während staatliche Unterstützung für Wohnraum und soziale Absicherung zurückging. In Kombination mit sozialen Problemen wie dem Einfluss der Crack-Epidemie in vielen Stadtteilen standen viele dieser Menschen früh vor Hürden wie Arbeitslosigkeit, Abhängigkeiten und Strafregistern, die ihren Zugang zu dauerhaftem Wohnen stark einschränkten. Die Inflation der Wohnungskosten trifft diese Generation besonders hart. Viele befinden sich in einer Lebensphase, in der sie nicht mehr die gleiche berufliche Flexibilität besitzen wie jüngere Generationen und zugleich nicht auf ausreichende Altersvorsorge zurückgreifen können. Die mangelnde Ersparnis und Absicherung zwingen sie in eine wirtschaftliche Abhängigkeit, oft von Eltern oder anderen Familienmitgliedern.
Mit dem Sterben dieser Unterstützer bricht für viele die letzte Schutzmauer weg, was die Obdachlosigkeit unter älteren Menschen dramatisch steigen lässt. Die Statistiken sind alarmierend: Innerhalb von nur wenigen Jahren ist die Zahl der obdachlosen Menschen über 65 um bis zu 50 Prozent gestiegen. Diese Entwicklung stellt die Gesellschaft vor neue Herausforderungen, während bislang die Obdachlosigkeit vor allem mit jüngeren Menschen in Verbindung gebracht wurde. Die Bedürfnisse älterer Obdachloser sind jedoch anders gelagert. Gesundheitliche Probleme und eingeschränkte Mobilität erfordern spezifische Unterstützungsangebote, damit diese Menschen nicht in Vergessenheit geraten und menschenwürdig leben können.
Die politische Landschaft hat bisher nur zögerlich auf diese Entwicklung reagiert. Zwar gibt es Programme zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit, diese sind aber oft nicht umfassend auf die speziellen Anforderungen der älteren Generation ausgerichtet. Zudem fehlen ausreichend finanzielle Mittel, um den wachsenden Bedarf an bezahlbarem Wohnraum zu decken. Die Verknüpfung von Arbeitsmarktpolitik, Sozialhilfe und Wohnungspolitik muss dringend verbessert werden, um präventiv entgegenzuwirken und langfristige Lösungen zu schaffen. Ein Ansatzpunkt ist die Stärkung familiärer Netzwerke und Nachbarschaften, doch auch diese geraten durch gesellschaftliche Veränderungen und zunehmende Mobilität unter Druck.
Die late babyboomer stehen somit stellvertretend für die Folgen struktureller Umbrüche in Wirtschaft und Gesellschaft. Ihr Schicksal zeigt, dass Armut und Obdachlosigkeit kein problematisches Randphänomen sind, sondern mit der demografischen Entwicklung und ökonomischen Bedingungen eng verknüpft sind. Veränderungen im sozialen Sicherungssystem müssen diese Realitäten anerkennen und den Fokus auf die besonderen Herausforderungen älterer Menschen legen, um die sich abzeichnende humanitäre Krise abzuwenden. Für Betroffene wie Anthony Forrest stellt Obdachlosigkeit nicht nur den Verlust von Unterkunft dar, sondern oft auch den Verlust von Würde, sozialer Teilhabe und gesundheitlicher Versorgung. Die Gesellschaft steht deshalb in der Verantwortung, nicht nur kurzfristig Soforthilfen zu leisten, sondern langfristig die Ursachen der Obdachlosigkeit anzugehen.