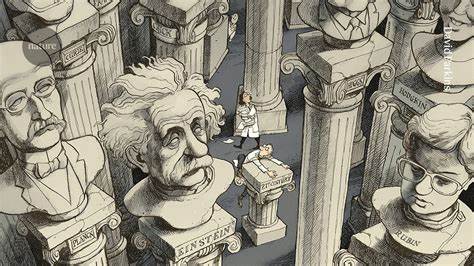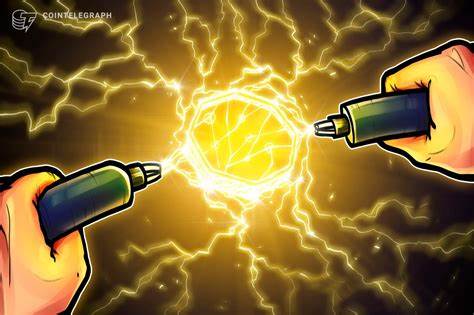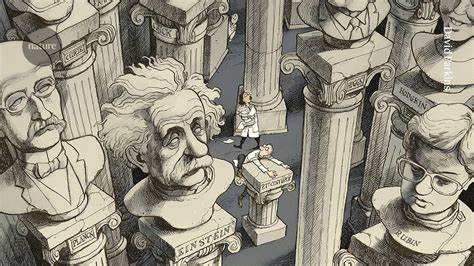Die westlichen Gebiete der Vereinigten Staaten zeichnen sich durch ihre vielfältigen und oft herausfordernden klimatischen Bedingungen aus. Vor allem der Wasserkreislauf in diesen Regionen ist von essenzieller Bedeutung, da er Millionen von Menschen mit Trinkwasser versorgt, landwirtschaftliche Produktion ermöglicht und Ökosysteme erhält. Jahrzehntelang galt die Annahme, dass der größte Teil des Schneeschmelzwassers direkt und relativ rasch nach der Schneeschmelze in Flüsse und Bäche gelangt. Neue Forschungen zeigen jedoch, dass dem nicht so ist. Vielmehr dominiert Grundwasser den Schneeschmelzwasserabfluss im Westen der USA, und dieser Einfluss wird in der Wasserwirtschaft oft unterschätzt oder falsch bewertet.
Wasser in den Bergen als lebenswichtige Ressource Die Gebirgsketten im Westen, darunter die Rocky Mountains, Sierra Nevada und Cascades, fungieren als „Wassertürme“ für weite Teile der USA. Während des Winters sammelt sich Schnee in großen Mengen an, der im Frühjahr und Sommer schmilzt und auf diese Weise einen Großteil des Oberflächenwassers speist. Da diese Regionen häufig semi-arid oder gar arid sind, ist eine gesicherte Wasserversorgung während der warmen Monate essentiell. Die bisherige Wasserwirtschaft basierte oft auf der Annahme, dass Schneeschmelzwasser unmittelbar und hauptsächlich oberflächennah in Flüsse gelangt und nur geringe Anteile ins Grundwasser versickern – zumindest in Bezug auf den direkten Beitrag zur Schneeschmelzphase. Revolutionäre Erkenntnisse durch Altersbestimmung von Wasser Eine neue Studie, die Anfang 2025 veröffentlicht wurde, verwendete modernste Tritium-Alterungsdatierung, um das Alter des Wassers in unterschiedlichen Phasen des Wasserzyklus zu bestimmen.
Tritium, ein radioaktives Wasserisotop, eignet sich hervorragend zur Altersbestimmung junger Wasservorkommen mit einem Halbwert von etwa 12,3 Jahren. Die Studie untersuchte 42 Gebirgs-Einzugsgebiete im westlichen Inland der USA im Zeitraum des Schneeschmelzzeitraums sowie der Winterruhephase (Basisabfluss). Die überraschende Entdeckung war, dass das durchschnittliche Alter des Wassers, das in den Flüssen während der Schneeschmelze abfließt, bei rund 5,7 Jahren liegt. Dieses Alter liegt deutlich über dem Alter von frisch gefallener Niederschlags- und Schneefallwasser und deutet darauf hin, dass ein Großteil des Wassers, das während der Schneeschmelze fließt, nicht direkt aus der aktuellen Schneeschmelze stammt, sondern bereits mehrere Jahre im Untergrund gespeichert war. Das Durchschnittsalter von Grundwasser, das den Basisabfluss speist, lag sogar noch höher bei rund 10,4 Jahren.
Daraus lässt sich schließen, dass ungefähr 58 Prozent des Schmelzwasserabflusses im Fließgewässer direkt aus älterem, zuvor gespeicherten Grundwasser stammen. Dieses sogenannte „alte Wasser“ wurde also mindestens ein Jahr vorher als Niederschlag aufgenommen und hat eine mehrjährige Verweildauer unter der Erdoberfläche. Geologische Einflüsse auf Wasserspeicherung und Alter Die Forscher konnten zudem feststellen, dass die Geologie der Einzugsgebiete eine große Rolle für die Wasserverweildauer spielt. In Regionen mit hartem, wenig durchlässigem Gestein wie Schiefer oder granitischen Formationen war das Wasser insgesamt jünger, die Grundwasserspeicher kleiner und die Umwandlung von Niederschlag in Flussabfluss effizienter. Im Gegensatz dazu zeigen Sedimentgesteine wie Sandstein oder klastische Schichten eine höhere Durchlässigkeit, was zu älterem Wasser und größeren Grundwasserspeichern führt.
Die Bedeutung dieser geologischen Unterschiede besteht darin, dass sie die Wasserdynamik maßgeblich beeinflussen. Hoch permeable Schichten wirken wie große Speicher und verzögern den Wasserfluss, wodurch das Gesamtvolumen an gespeicherter Feuchtigkeit steigt und das Wasser erst nach längerer Zeitspanne zur Flussabgabe gelangt. Dadurch wird die saisonale Wasserführung ausgeglichener und wetterbedingte Schwankungen werden abgefedert. In Gegenden mit weniger durchlässigem Gestein kann Wasser schneller abfließen, was zu zeitlich stärkeren, volatileren Abflussreaktionen führt. Neue Konzepte für die Modellierung von Wasserhaushalten Die Entdeckung, dass Grundwasser den Schneeschmelzwasserabfluss überwiegend bestimmt, stellt viele bisherige Wasserhaushaltsmodelle infrage.
Traditionelle Modelle gehen meist von einer Annahme der sogenannten „Jahreswasserbilanzschließung“ aus – das heißt, Wasser, das in einem Jahr nicht genutzt wird, fließt spätestens im nächsten wieder ab. Diese Annahme ignoriert Speicherprozesse, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Auch wird bislang häufig angenommen, dass vor allem der Oberflächenabfluss und oberflächennahes Bodenwasser den Flusslauf prägen. Die neuen Erkenntnisse zeigen, dass viel größere Volumina an Wasser in tieferen Bodenschichten, Saprolith (verwittertes Gestein) und Grundwasser gespeichert werden. Diese Kapazitäten sind ein Vielfaches größer als jene der oberflächennahen Bodenschicht.
Sie spielen eine entscheidende Rolle für die Wasserführung in den Gebirgsbächen, indem sie vergangene Jahre mit Niederschlag in das aktuelle Wassersystem einbringen. Dies macht die Wasserführung weniger anfällig für kurzfristige Niederschlagsausfälle, erhöht aber auch die Komplexität, da Dynamiken über mehrere Jahre modelliert werden müssen. Auswirkungen auf Ökosysteme und Landnutzung Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Wasserverfügbarkeit für Pflanzen. Studien legen nahe, dass viele Bergökosysteme über Wasserressourcen verfügen, die aus diesen langzeitigen Grundwasserspeichern stammen. Insbesondere Wälder und andere Vegetation benötigen ein gewissen Maß an verfügbarer Feuchte, selbst in Trockenzeiten.
Dieses langfristige Wasserreservoir kann Pflanzen in Dürreperioden über mehrere Jahre stützen. Dies bedeutet auch, dass Veränderung der Landnutzung, Entwaldung, Brände oder andere ökologische Eingriffe auf die Dynamik dieser Grundwasserspeicher wirken können. Die Fähigkeit von Wäldern, Wasser aufzunehmen und zu speichern wird somit zu einem wichtigen Faktor sowohl für den regionalen Wasserhaushalt als auch für das Klima. Klimawandel und zukünftige Herausforderungen Die Funde gewinnen angesichts des fortschreitenden Klimawandels und der anhaltenden Dürrebedingungen im Westen der USA an Bedeutung. Höhere Temperaturen führen zu geringeren Schneefällen, schnelleren Schmelzprozessen und veränderten Niederschlagsmustern.
Die Konsequenzen für die Grundwasserreserven sind noch kaum verstanden, doch sie könnten gravierend sein. Solch langfristige Speicherseen sind möglicherweise in Zukunft weniger zuverlässig, was für die Trinkwasserversorgung, Bewässerungslandwirtschaft und Ökosysteme problematisch werden kann. Gleichzeitig könnte die Verzögerung im Abflusswasser zwischen Niederschlags-Ereignis und Flussabfluss durch veränderte Temperatur- und Niederschlagsmuster noch heterogener werden. Diese Unsicherheiten verdeutlichen, dass Wassermanagement und Planungen die Rolle des Grundwassers als Speicher und Puffer künftig stärker miteinbeziehen müssen. Nur so lassen sich Wasserressourcen nachhaltig nutzen und gleichzeitig auf wechselnde Bedingungen reagieren.
Praktische Implikationen für Wassermanager Angesichts dieses neuen Verständnisses ist es für Wassermanager sinnvoll, die Altersbestimmung von Wasser und die Überwachung von Grundwasserspeichern in ihre Planungen stärker einzubeziehen. Biannuelle Tritium-Messungen während der Winterperiode und im Schneeschmelzzeitraum können wertvolle Informationen über den Zustand der Grundwasserspeicher liefern. Dadurch können die Volumen des verfügbaren Speichers und seine zukünftige Entwicklung besser abgeschätzt werden. Die Verknüpfung dieser Daten mit hydrologischen Modellen kann die Prognosegenauigkeit von Flussabflüssen erheblich erhöhen. Das ermöglicht eine bessere Vorbereitung auf Trockenzeiten und langfristige Versorgungsplanung.
Auch bei naturräumlichen Eingriffen, wie etwa der Aufforstung oder der Landbewirtschaftung, können geologische Daten zur Abschätzung der Druckfestigkeit der Wasserspeicher herangezogen werden. Fazit Die Erkenntnis, dass Grundwasser den Großteil des Schneeschmelzwasserabflusses im Westen der USA steuert, markiert einen Wendepunkt in unserem Verständnis zentraler hydrologischer Prozesse. Das Wasser, das viele Flüsse im Frühling und Sommer speist, ist oft Jahre alt und resultiert aus komplexen Speicher- und Fließvorgängen im geologischen Untergrund. Diese Tatsache eröffnet nicht nur neue Forschungsperspektiven, sondern fordert auch einen Paradigmenwechsel in der Wasserwirtschaft, der Planung und auch im ökologischen Schutz. In einer Welt mit zunehmendem Klimawandel und wachsender Wasserknappheit sind genaue Kenntnisse über die Zeit und Dynamik der Wasserspeicherung unverzichtbar.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die Wasserversorgung nachhaltig sichergestellt wird, Ökosysteme geschützt bleiben und Gesellschaften sich an sich wandelnde Umweltbedingungen flexibel anpassen können.