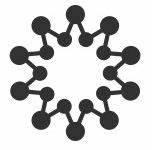In einer Zeit, in der Nordkorea durch internationale Sanktionen zunehmend am wirtschaftlichen Leben gehindert wird, sucht das Land nach innovativen Wegen, seine dringend benötigten Devisenquellen zu erweitern. Ein bemerkenswerter Schritt in diese Richtung ist der geheim durchgeführte Test mit dem Verkauf von NFTs (Non-Fungible Tokens) in China, der von Januar bis Mai 2025 stattfand. Diese Entwicklung wirft ein neues Licht auf die vielfältigen Strategien Pjöngjangs, trotz schwieriger Rahmenbedingungen wirtschaftliche Aktivitäten außerhalb des Landes zu entfalten. Die hinter diesem Vorhaben stehenden technischen Teams des Korea Computer Centers, einer führenden nordkoreanischen Technologiebasis, haben sich in China als Handelsvertreter getarnt, um die Verkaufsmöglichkeiten und technischen Voraussetzungen von NFTs auf ausländischen Marktplätzen zu erproben. Die Wahl Chinas als Experimentierfeld ist dabei strategisch, da das Nachbarland nicht nur geografisch zugänglich ist, sondern auch ein bedeutendes Umfeld für digitale Innovationen und Kryptowährungen darstellt.
Zudem ist es ein wichtiges Transitland für Nordkorea bei der Umgehung von Sanktionen. Die Tester konzentrierten sich nicht nur darauf, NFTs an sich zu verkaufen, sondern interessierten sich vornehmlich für die zugrundeliegende Infrastruktur der NFT-Marktplätze, insbesondere solche im südostasiatischen Raum wie in Thailand und den Philippinen. Diese Märkte bieten laut Berichten weniger strenge Identifikationskontrollen, was die Anonymität bei Transaktionen erhöht und somit für Nordkorea von besonderem Interesse ist. Ein zentrales Ziel war es, Eigentumsrechte über digitale Blockchain-Wallets zu verschleiern und Einnahmen über Drittlandunternehmen zu verschleusen, um die Herkunft und den Besitz der NFTs zu verschleiern. Das verwendete digitale Gutmaterial war dabei ausgesprochen speziell und spiegelte die nordkoreanische Identität wider.
Fotos der berühmten Berglandschaft des Mount Kumgang, Bilder traditioneller Goryeo-Celadon-Keramik sowie detaillierte Karten interner nordkoreanischer Bergbaugebiete wurden digitalisiert und in NFT-Formate umgewandelt. Diese einzigartige Auswahl an Inhalten soll die Attraktivität der NFTs erhöhen und gleichzeitig einen gewissen Exklusivitätswert bieten, der für Sammler interessant sein könnte. Für die praktische Durchführung mieteten die Teams mehrere Standorte in chinesischen Städten wie Peking und Zhuzhou (Provinz Hunan). Die firmierten Aktivitäten liefen unter Decknamen real existierender Unternehmen, etwa aus dem Tourismussektor und der Immobilienentwicklung. Dadurch konnte das Team relativ verdeckt agieren und Spuren verwischen.
Nach der fünfmonatigen Phase wurde der Versuch jedoch eingestellt, die Beteiligten zogen sich zurück und hinterließen keine greifbaren Spuren am Einsatzort. Die abschließende Analyse zeigte, dass die technische Umsetzung von NFT-Verkäufen und die Generierung von Devisen prinzipiell durchaus möglich sind. Jedoch stellten sich diverse praktische und institutionelle Hindernisse als signifikante Hemmnisse heraus. Die chinesischen Rechtsvorschriften zur digitalen Vermögensverwaltung sind restriktiv und bergen hohe Risiken für ausländische Akteure. Zudem ist die Stabilität und Vertrauenswürdigkeit südostasiatischer NFT-Marktplätze nicht garantiert, was Investoren und Digitalverkäufer gleichermaßen abschrecken könnte.
Ein weiterer limitierender Faktor sind die hohen Betriebskosten im Verhältnis zu den erzielbaren Einnahmen. Die Komplexität und der Aufwand für Wartung, Überwachung sowie die Verschleierung der Transaktionen machen die Unternehmung langfristig wenig profitabel. Obwohl es in Nordkorea Hoffnung gab, NFTs als neuartige Instrumente zur Umgehung von Sanktionen zu nutzen, wurde diese Strategie als ineffizient und kurzfristig wenig erfolgversprechend eingestuft. Nordkoreas Experiment mit NFTs ist allerdings keine isolierte Aktion, sondern Teil einer breiteren Palette von Methoden, um im internationalen Finanzsystem dennoch Einnahmen zu generieren. Blockchains und Kryptowährungen wurden schon seit einigen Jahren ins Auge gefasst, da sie theoretisch ein hohes Maß an Anonymität bieten.
Der NFT-Test zeigt nun, dass auch traditionelle digitale Vermögenswerte in Form von einzigartigen Bildern und Informationen für solche Zwecke in Betracht gezogen werden. Die bisherigen Schwierigkeiten verdeutlichen jedoch, dass der Übergang von theoretischen Möglichkeiten zu realen und profitablen Devisenquellen steinig ist. Technische Umsetzbarkeit ist wichtig, aber ohne stabile und rechtlich abgesicherte Marktplattformen sowie akzeptable Kostenstrukturen bleibt der angenommene Nutzen begrenzt. Nordkorea steht somit vor der Herausforderung, seine digitalen Experimente weiter zu verbessern und eventuell neue Wege zu finden, um die technischen und regulatorischen Barrieren zu überwinden. Ein Aspekt, der bislang wenig Beachtung findet, ist die Qualität und Exklusivität des produzierten nordkoreanischen NFT-Inhalts.
Das Land könnte zukünftig versuchen, seine kulturellen und geographischen Besonderheiten stärker als Alleinstellungsmerkmal digital zu vermarkten. In Kombination mit einem verbesserten Netzwerk von Kryptowährungsbörsen oder sogar eigens kontrollierten Plattformen könnte so langfristig ein stabilerer Markt entstehen. Die Bedeutung von China in diesem Kontext kann nicht übersehen werden. Trotz der strikten politischen Haltung gegenüber Nordkorea ist die Volksrepublik oftmals einer der wichtigsten Handelspartner gerade im Bereich Schmuggel und inoffizieller Geschäfte. Die ausgewählten Standorte in China weisen darauf hin, dass Nordkoreas digitale Strategien gezielt den infrastrukturellen Vorteil des Nachbarn mitnutzen wollen.
Es bleibt abzuwarten, wie China zukünftig auf solche Aktivitäten reagieren wird, insbesondere da das Land selbst zunehmende Regulierung im Bereich Kryptowährungen betreibt. Die internationale Gemeinschaft verfolgt diese Entwicklungen mit Argwohn. NFTs und Kryptowährungen gelten als potenzielle Instrumente zur Umgehung von Sanktionen und zur Finanzierung nicht genehmigter Aktivitäten. Der NFT-Test Nordkoreas ist daher nicht nur eine technologische Herausforderung, sondern auch ein geopolitisches Signal. Er zeigt, wie digitale Transformation neue Konfliktfelder schaffen kann, in denen traditionelle staatliche Kontrollen ihre Wirksamkeit verlieren.