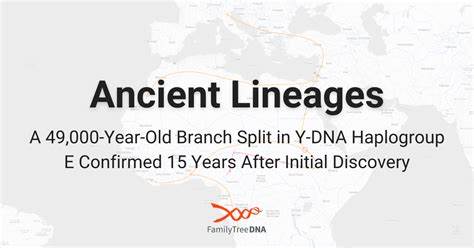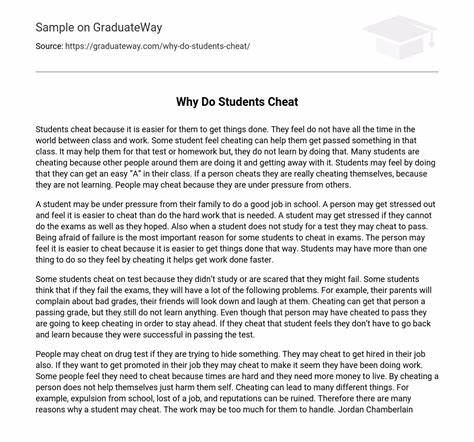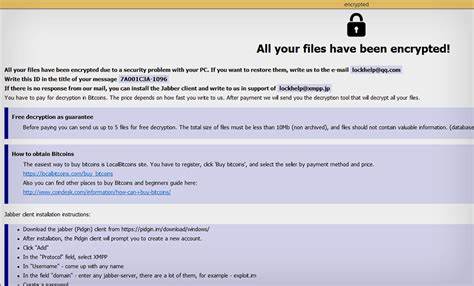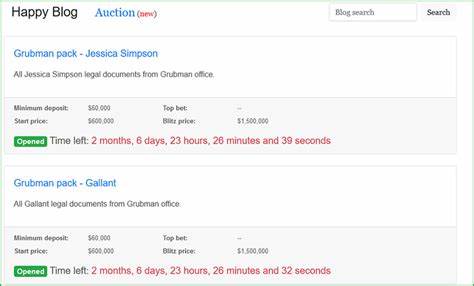Die Sahara gilt heute als eine der trockensten und lebensfeindlichsten Regionen der Welt, doch in prähistorischer Zeit präsentierte sich diese Wüstenlandschaft während des sogenannten Afrikanischen Feuchtzeitraums als blühende, grüne Savanne. Diese grüne Sahara erstreckte sich ungefähr von 14.500 bis 5.000 Jahren vor unserer Zeit und bot lebenswichtige Wasserressourcen, die Menschen die Besiedelung der Region ermöglichten. Auf diesem Gebiet entstanden komplexe Gesellschaften mit Jäger- und Sammlertraditionen, die teils schon erste Formen von Viehzucht und Pastoralismus pflegten.
Die Erkenntnisse aus jüngster archäogenetischer Forschung revolutionieren unser Verständnis der Bevölkerungsdynamik und genetischen Herkunft Nordafrikas in dieser Zeit. Doch viele Fragen blieben lange unbeantwortet, da das heiße und trockene Klima der Sahara die Erhaltung von DNA erschwert – bis nun erstmals genomweite Daten aus etwa 7.000 Jahre alten menschlichen Überresten der Mittel-Sahara in Libyen verfügbar sind. Die Takarkori-Fundstätte in den Tadrart Acacus-Bergen Südwestlibyens ist ein einzigartiges Fenster in die prähistorische Geschichte der Grünen Sahara. Hier wurden aus mehreren menschlichen Bestattungen insbesondere zwei weibliche Individuen der Pastoralneolithischen Epoche untersucht, deren DNA neue genetische Informationen liefert.
Die Analyse ihrer Genome zeigte, dass diese Individuen eine bislang unbekannte ursprüngliche nordafrikanische Abstammung repräsentieren. Diese Population hat sich bereits vor der breitflächigen Ausbreitung der modernen menschlichen Populationen außerhalb Afrikas von sub-saharischen Linien getrennt und blieb über lange Zeit isoliert. Interessanterweise besteht eine enge Verwandtschaft zu den etwa 15.000 Jahre alten Jägern von der Höhle Taforalt in Marokko, deren Genome bereits in früheren Studien entschlüsselt wurden. Diese Taforalt-Menschen gelten als Vertreter der sogenannten Iberomaurusischen Kultur, die lange vor dem Höhepunkt des Afrikanischen Feuchtzeitraums existierte.
Diese genetische Verbindung zwischen Takarkori und Taforalt weist auf eine stabile Population in Nordafrika hin, die sich über eine sehr lange Zeitspanne entwickelt hat und trotz klimatischer Schwankungen weitgehend genetisch isoliert blieb. Besonders bemerkenswert ist, dass trotz der „grünen“ Verhältnisse und günstigen Lebensbedingungen während der Feuchtzeit kaum genetischer Austausch mit sub-saharischen Populationen stattfand. Das bedeutet, dass der Sahara oft eine genetische Barriere war, obwohl menschliche Gruppen sich kulturell austauschten und möglicherweise Handel trieben. Die genetische Distanz unterstreicht, dass biologische Vermischung über den Sahara-Grünzeitraum hinweg begrenzt blieb. Ein weiterer faszinierender Befund betrifft die Verteilung der Neandertaler-DNA.
Heutige Menschen außerhalb Afrikas tragen zwischen ein und drei Prozent Neandertaler-Gene in sich, da ihre Vorfahren damals unter anderem mit diesen Urzeit-Menschen vermischten. Die Takarkori-Individuen weisen jedoch nur sehr geringe Mengen Neandertaler-DNA auf, etwa ein Zehntel dessen, was bei frühen neolithischen Gruppen im Nahen Osten gefunden wurde. Gleichzeitig besitzen sie etwas mehr dieser uralten DNA als heutige reine sub-saharische Populationen. Dies spricht für wenige, aber erkennbare Kontakte oder gemeinsamen Ursprung mit Populationen, die aus Afrika ausgewandert sind und sich kurzzeitig mit Neandertalern vermischten. Demnach hat die isolierte nordafrikanische Linie der Grünen Sahara zwar wenig Kontakt mit den damals außerhalb Afrikas lebenden Menschen gehabt, aber eine gewisse erbliche Spur davon blieb erhalten.
Die genetischen Ergebnisse unterstützen zudem archäologische Hypothesen zur Verbreitung des Pastoralismus in der Sahara. Es ist wenig wahrscheinlich, dass die ersten Hirtenvölker und ihre domestizierten Tiere durch große migrationsbewegungen aus dem Nahen Osten in die Mittel-Sahara gelangten. Stattdessen scheint sich das Wissen um Viehzucht kulturell weiterverbreitet zu haben, während die ursprüngliche Bevölkerung, wie die Takarkori-Individuen zeigen, genetisch weitgehend stabil blieb. Diese kulturelle Diffusion ermöglichte die Etablierung der Viehwirtschaft bei einer Menschenpopulation, die vermutlich bereits seit dem Spätpleistozän im nordafrikanischen Raum verankert war. Mitochondriale DNA-Analysen, die ausschließlich die mütterliche Erblinie berücksichtigen, zeigten, dass die untersuchten Individuen eine sehr basale Haplogruppe N tragen.
Diese Linie ist eine der frühesten überhaupt außerhalb von Sub-Sahara-Afrika und bietet Einblicke in einen frühen Stammbaum der menschlichen Mitochondrien-DNA. Die auf circa 61.000 Jahre vor heute geschätzte Zeit dieser Linie lässt vermuten, dass Nordafrika ein wichtiges Refugium für frühe moderne Menschen sein könnte und möglicherweise eine Quelle für spätere Bevölkerungsbewegungen darstellte. Die Takarkori-Daten werfen zudem neues Licht auf die Besiedlungsgeschichte und Genetik anderer alt-nordafrikanischer Gruppen. Insbesondere konnten die Forscher nachweisen, dass das afrikanische Erbgut bei den Taforalt-Menschen, das zuvor als sub-saharisch eingeordnet worden war, wahrscheinlich enger mit der Takarkori-Linie verwandt ist.
Dies bedeutet, dass das „sub-saharische“ Erbe ein eigentlich nordafrikanisches Erbe ist, das bereits vor Jahrtausenden eine eigene lange Entwicklungsgeschichte besaß. So wird die genetische Realität Nordafrikas komplexer und in sich differenzierter beschrieben als bisher gedacht. Um die Verhältnisse zwischen afrikanischen und außereuropäischen Populationen umfassend zu verstehen, wurden die Takarkori-Genomdaten mit dem sogenannten Zlatý kůň-Genom verglichen. Dieses stammt von dem ältesten bislang sequenzierten modernen Menschen (45.000 Jahre alt) aus Mitteleuropa und dient als Referenz für die menschlichen Außereuropa-Stämme.
Die Takarkori-Gruppe weist eine gewisse Nähe zu diesem Zweig auf, was nahelegt, dass sie eine Abstammungslinie darstellen, die sich nach der „Out-of-Africa“-Auswanderung entwickelte, aber innerhalb Afrikas verblieb. Neben den genetischen Daten ergaben archäologische Funde in Takarkori und der Region viele Hinweise auf hochentwickelte kulturelle Traditionen. Diese reichen von der Nutzung von Keramik und Werkzeugen über Textilien bis hin zu transhumantem Hirtenleben über weite Distanzen hinweg. Die kulturelle Komplexität dieser Populationen belegt eine lange, kontinuierliche Besiedlung mit eigener Innovationskraft. Es zeigt sich, dass die Sahara trotz vorübergehender günstiger klimatischer Bedingungen weiterhin eine starke Barriere für genetischen Austausch war.
Die genetische Distanz zwischen nördlichen und südlichen afrikanischen Populationen wurde auch durch ökologische und kulturelle Faktoren beeinflusst. So blieben demnach Populationen wie die der Takarkori-Hirten genetisch isoliert, während kulturelle und materielle Innovationen, wie die Viehhaltung, wohl eher durch Ideen- und Technologietransfer verbreitet wurden. Diese neuen Forschungsergebnisse tragen wesentlich zum Verständnis der komplexen Geschichte Nordafrikas und des Sahararaums bei. Sie zeigen, dass Nordafrika eine lange eigene genetische Entwicklung aufweist, die eng mit dem Nahen Osten, aber auch unabhängig von sub-saharischen Linien verknüpft ist. Die Analyse antiker DNA aus der Grünen Sahara ist damit ein Meilenstein, der nebeneinander genetische Isolation, kulturellen Austausch und die frühe Ausbreitung von wichtigen lebenswichtigen Praktiken wie der Viehzucht in einem der einst lebendigsten Teile Afrikas verdeutlicht.
Für die Zukunft kann erwartet werden, dass weitere archäogenetische Untersuchungen in Nordafrika und der Sahara diesen komplexen genetischen und kulturellen Mosaikcharakter noch detaillierter abbilden werden. Insbesondere könnten künftig Proben von anderen Fundstellen und Zeitphasen genauere Einblicke gewähren, wie sich Populationen vor, während und nach klimatischen Veränderungen entwickelten und miteinander interagierten. Die archäogenetischen Methoden werden durch ständig verbesserte Sequenzierungsverfahren und eine zunehmend größere Vergleichsdatenbasis weiter verfeinert, sodass bald noch präziser nachvollziehbar wird, wie die Menschen in der Grünen Sahara lebten, sich bewegten und welche genetischen Linien daraus hervorgingen. Das Verständnis der antiken genetischen Landschaft Nordafrikas liefert nicht nur spannende Einsichten in die Geschichte dieser Region, sondern auch in die breitere Geschichte der Menschheit und unserer gemeinsamen Abstammung. Die Erkenntnisse aus dem Takarkori-Projekt zeigen eindrücklich, dass genetische Vielfalt und kulturelle Entwicklungen nicht immer parallel verlaufen müssen.