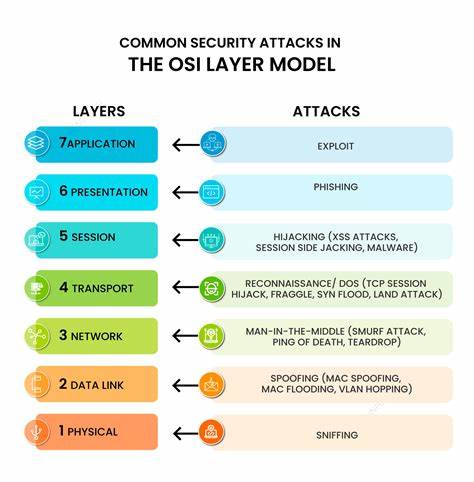Terrestrische Gammastrahlenblitze, kurz TGFs, sind extrem kurze Ausbrüche hochenergetischer Photonen, die in Zusammenhang mit Gewitterblitzen auftreten. Diese faszinierenden Ereignisse wurden erstmals 1994 entdeckt und sind seitdem vor allem durch Detektionen aus dem Weltraum bekannt. Doch die genaue Entstehung und das Zusammenspiel der elektrischen und atmosphärischen Bedingungen, die zu solchen Blitzen führen, sind nach wie vor Gegenstand intensiver Forschung. Durch neue bodengestützte Beobachtungen in Japan gelang es Wissenschaftlern nun, einen derartigen Gamma-Blitz in direktem Zusammenhang mit einem Blitz auf einem Fernseh-Übertragungsturm zu beobachten und so wichtige Details zu den Entstehungsmechanismen zu entschlüsseln. TGFs sind extrem energiereiche Ereignisse, die normalerweise innerhalb weniger hundert Mikrosekunden auftreten und Photonen im Bereich von mehreren Megaelektronenvolt (MeV) emittieren – Energielevel, die denen kosmischer Prozesse ähneln.
Ihre Gesetzmäßigkeiten gewinnen zunehmend an Interesse, weil sie wertvolle Einblicke in Prozesse hochenergetischer Elektronen und elektrischer Felder in der dichten Erdatmosphäre bieten, was wiederum das Verständnis von Gewittern und der Atmosphärenphysik insgesamt bereichert. In der Regel wurden TGFs bisher von weltraumbasierten Instrumenten registriert, die von Satelliten oder der Internationalen Raumstation aus in die Atmosphäre blicken. Diese Missionen konnten Hunderte von TGFs erfassen, doch die extrem kurze Dauer und die große Entfernung machen eine genaue Analyse der Entstehung vor Ort schwierig. Deshalb ist die direkte bodengestützte Beobachtung eine wichtige Entwicklung im Kampf um das Verständnis der genauen physikalischen Prozesse hinter einem TGF. Im Hokuriku-Gebiet entlang der Küste des Japanischen Meeres, bekannt für seine winterlichen Gewitter, konnten Forscher eine einzigartige Konstellation nutzen.
Die häufigen Blitzentladungen auf zwei benachbarten Fernsehtürmen in Kanazawa boten eine ideale Chance, um TGFs mit hochenergetischen Detektoren zusammen mit Radiowellenmessungen und optischen Kameras zu erfassen. Das Gebiet weist aufgrund niedrigerer Wolkenbasen und typischer elektrischer Strukturen besonders gute Bedingungen für den Nachweis sogenannter „downward TGFs“ auf – also Gammastrahlenblitze, deren Strahlung nach unten in Richtung Erdoberfläche gerichtet ist. Bei der beobachteten Blitzentladung wurde ein elektrischer Prozess ablaufend dokumentiert, bei dem ein abwärts gerichteter negativer Blitzleiter mit einem aufwärts gerichteten positiven Blitzleiter vom Turm kollidierte. Genau dieser Kontaktpunkt erzeugte ein stark kompaktes elektrisches Feld, mit dem Millionen von Elektronen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt wurden. Durch diese Beschleunigung kam es zur Entstehung der Gamma-Strahlenblitze.
Die Messungen zeigten, dass der erste Gammaimpuls wenige Mikrosekunden vor dem sogenannten „return stroke“, dem Hauptentladungspunkt des Blitzes, ausgelöst wurde. Die Forscher verwendeten eine Kombination aus hochempfindlichen Szintillationsdetektoren für die Gamma-Strahlung, einem Radiomessnetzwerk, das sowohl VHF- als auch LF-Bänder abdeckt, sowie optische Kameras, um das Geschehen in sämtlichen relevanten Frequenzbereichen nachzuverfolgen. Die präzise geographische Ortung der Radiopulse erlaubte eine dreidimensionale Rekonstruktion der Entladungsverläufe und bestätigte den Zusammenstoß der zwei Leiter in etwa 800 bis 900 Metern Höhe. Besonders bemerkenswert war die Dauer und Intensität des TGFs. Typischerweise dauern solche Blitze nur einige hundert Mikrosekunden, doch hier dauerte das Gamma-Signal länger an, begleitet von einem Nachglimmen, das auf die Entstehung von Neutronen durch photonukleare Reaktionen hinweist.
Solche Reaktionen entstehen durch Energien von über 10 MeV und führen zur Freisetzung von Neutronen, deren Interaktion mit der Atmosphäre wiederum weitere charakteristische Signale hervorruft. Die deutliche Beobachtung von TGFs in Verbindung mit einem Leader-Kollisionsprozess bringt wichtige Erkenntnisse für die Theorien über die Beschleunigung der Elektronen. Bisher herrschte die Rekativistische Runaway-Elektronenlawine als dominantes Model vor, allerdings konnten die klassischen Ansätze die Auftretenshäufigkeit und Energie von TGFs nicht vollständig erklären. Die neue Beobachtung unterstützt die Vorstellung, dass starke und sehr kompakte elektrische Felder zwischen zwei sich annähernden Blitzleitern die Beschleunigung der Elektronen weiter intensivieren und zu den beobachteten Gammastrahlenblitzen führen. Ein weiterer Aspekt dieser Forschungsarbeit ist die außergewöhnliche Länge des aufwärts gerichteten positiven Blitzleiters vom Turm, die mit etwa 800 Metern deutlich länger war als bei den meisten natürlichen, negativen Gewitterblitzen in anderen Regionen.
Diese enorme Leitungslänge deutet auf eine außergewöhnlich starke Ladungsdifferenzierung und elektrische Potentialdifferenz innerhalb der Wolke und zwischen Wolke und Boden hin. Die Kombination aus multidisziplinären Beobachtungsmethoden – optische Kameras, hochauflösende Radiowellen-Datennetze und hochempfindliche Gamma-Detektoren – macht diese Forschung besonders aussagekräftig. Sie ermöglicht es, die komplexen Blitzprozesse auf Mikrosekundenebene und auf räumlichen Skalen von wenigen hundert Metern genau zu verfolgen. Zudem erlauben technische Fortschritte in der zeitlichen Synchronisation und Lokalisierung eine präzise Zuordnung von Strahlenereignissen zu Blitzelementen, was zuvor kaum realisierbar war. Von besonderem Interesse sind auch die Einblicke in die sogenannte „attachment process“, also die Verbindung zweier Blitzleiter mit gegensätzlicher Polarität.
Die Entdeckung, dass TGFs meist unmittelbar vor dem Rückstrahl, beim Annähern beider Leiter, entstehen, eröffnet neue Perspektiven für das Verständnis der Entstehung elektrischer Felder mit einer Stärke, die über bisherige Annahmen hinausgeht. Dieses verbesserte Verständnis könnte auch Auswirkungen auf die Blitzschutzforschung und die Modellierung elektrostatischer Phänomene in Gewittern haben. Die in Kanazawa gewonnenen Erkenntnisse fügen sich zudem in ein wachsendes Bild globaler Beobachtungen von TGFs ein. Ähnliche Ereignisse wurden auch in den USA, Europa und der Karibik beobachtet, allerdings meist aus der Distanz oder aus der Luft. Die Bodenbeobachtung mit einer Vielzahl von Datenquellen erlaubt es nun erstmals, die physikalischen Zusammenhänge sehr detailliert zu untersuchen und macht eine Verbindung zwischen hochenergetischer Strahlung und Blitzführung nachvollziehbar.
Zukünftige Forschungen dürften sich vermehrt auf solche multidisziplinären Ansätze konzentrieren, um weitere Einflussfaktoren von TGFs zu analysieren. Die Entwicklung neuer Detektoren mit höherer Empfindlichkeit und schnellerer Datenverarbeitung wird ebenfalls die Aufklärung der genauen Beschleunigungsmechanismen erleichtern. Insbesondere die Frage, inwiefern unterschiedliche Blitzarten, atmosphärische Bedingungen und elektrische Strukturen den Ausgang von TGFs beeinflussen, bleibt weiterhin spannend. Neben wissenschaftlichen Erkenntnissen haben TGFs auch praktische Relevanz. Die hochenergetische Strahlung, die teilweise bis zum Erdboden reicht, kann elektronische Geräte stören, Satelliten beeinträchtigen und Sicherheitsrisiken für Flugzeugbesatzungen darstellen.



![First Update from Dianna (Physics Girl) [video]](/images/52FBD09B-0BB0-4ABA-B587-49E90B664C4F)